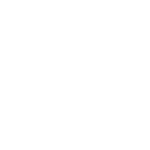Neue Zollbestimmungen, imperialistische Visionen und die scheinbare Annäherung des US-amerikanischen Präsidenten in Richtung russischer Narrative. „Wir hätten uns vorbereiten können“, sagt Cathryn Clüver Ashbrook, Expertin für Außenpolitik.

Cathryn Clüver Ashbrook ist eine deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen der Bertelsmann-Stiftung. Zu ihren Fachgebieten zählen auch die europäische Sicherheitspolitik und die Zukunft der Demokratie. Von Juni 2021 bis Februar 2022 war sie Direktorin und Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Als geschäftsführende Vizepräsidentin lädt Clüver Ashbrook zum Gespräch in das Gebäude der Bertelsmann-Stiftung auf der Museumsinsel in Berlin ein.
politikorange: Der Rauswurf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjs durch seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump aus dem Weißen Haus und die plötzliche Übernahme kreml-naher Rhetorik verunsichern europäische Partner*innen. Wird Russlands Präsident Wladimir Putin mittlerweile als Verhandler, nicht als Verbrecher gesehen?
Cathryn Clüver Ashbrook: Für Donald Trump gilt in erster Linie immer, alles medienwirksam zu machen, was in seinen Bereich fällt. Er verdreht die Fakten und schafft sich seine eigene Wahrheit. Diese besagt nun, dass Russland unter Umständen bereiter für einen Frieden sei und die Ukraine der Aggressor.
Welche Druckmittel verliert der Westen gerade?
Das Verteidigungsministerium hat angekündigt, offensive Cyberattacken auf die Russische Föderation einzustellen, obwohl US-Behörden und der Außengeheimdienst seit 2016 einen Angriff der russischen Staatsstellen auf unterschiedliche Institutionen im amerikanischen gesellschaftlich-politischen und sozialen System beobachten nachweisen können. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und die Cyber- und Desinformationskampagnen gegenüber Europa nehmen seit Jahren zu. Gleichzeitig werden die Waffenlieferungen an die Ukraine instrumentalisiert um die Ukraine – das Opfer des russischen Angriffs – zu Zugeständnissen zu zwingen.
Russland hat auch die Minimalziele bisheriger Gespräche nicht eingehalten, weist nun Bemühungen der Trump-Regierung von der Hand – trotzdem kommt die USA Russland beim von der Trump-Regierung angezettelten Handelskrieg Russland entgegen, spart es als einziges großes Land von Zollauflagen aus. Das ist in einer Verhandlungssituation fast unverständlich, weil es die amerikanische und damit auch die europäische Position schwächt.
Nutzt oder nutzte Trump den Einfluss russischer Akteur*innen in irgendeiner Form? Gibt es da ein Motiv?
Das wissen wir seit dem Bericht von Robert Mueller als Sonderermittler 2016, der russischen Einfluss auf die US-Wahl im Wahljahr belegen sollte. Er konnte zwar keine strafbaren Handlungen nachweisen, aber sehr wohl, dass es massiven staatlichen Einfluss der russischen Föderation gegeben hat. Illegale Parteispenden und Ähnliches werden immer auf Einzelpersonen abgewälzt, das zeigt ein Muster und eine koordinierte Beeinflussung, um die Demokratie in ihrer Funktionalität zu schwächen. Und zwar überall, wo sie als besonders resilient gilt.
In den USA, aber auch in Europa streut diese breit angelegte Kampagne Desinformation, arbeitet so mit dem starken Wahlmotiv des Unmuts und treibt Wähler in die Arme der radikalen Parteien, die sich z.T. gegen die demokratische Grundordnung positionieren. Das genau will das Regime Putin erreichen.
„Make America great again“, tönte Trump auch im vergangenen Wahlkampf wieder. Glaubt er wirklich, mit diesen Entscheidungen, dieser russlandfreundlichen Politik, den USA zu alter Größe zu verhelfen?
Für Donald Trump geht es in erster Linie um Donald Trump. Das haben wir in der ersten Amtszeit gesehen, als er seine Familie eingesetzt hat, um ganz bestimmte Assets zu beschützen. Hinter ihm aber steht eine viel besser organisierte Bewegung, die auf der Basis einer Falschauslegung eines exkludierenen christlich-weißen nationalistischen Ethos agiert, wie J.D. Vance es beispielsweise tut. In dieser Hinsicht beeindruckt die Härte Vladimir Putins in Sachen kultureller Kontrolle das Team Trump, das Vorgehen gegen LGBTQI Gruppen in Russland, zum Beispiel, auch wenn es auf einem völlig falschen Verständnis russischer Realitäten beruht und die große Diversität der Russischen Föderation ignoriert. Im Übrigen hat die Auslegung einer hierarchisch-geordneten christlichen Nächstenliebe, wie von J.D. Vance geäußert, wenig mit der biblischen Definition zu tun, was man gut im Streitgespräch mit dem Papst gut beobachten konnte.

Es geht um den sozialen Ausschluss bestimmter Gruppen, was die Macht-Hierarchien angeht, und das geht nun auch mit Korruption einher. Auch die oligarchische Strategie Russlands scheint Trump zu beeindrucken, bzw. ist er Geldgebern aus Russland persönlich verpflichtet.
Einerseits erwachsen diese aus den „Tech-Bros“ in großen Medienunternehmen und auf der anderen Seite wissen wir, dass Donald Trump sich in seiner Karriere als Geschäftsmann in Manhattan Kredite durch russische Gelder hat erleichtern lassen. Bei einer normalen Senatsprüfung wäre sowas ein „Conflict of Interest“. Wir wissen nicht, wie viel Kompromat ein russischer Staatschef gegenüber Donald Trump hat. In Summe ist aber der augenscheinliche Seitenwechsel in der Unterstützung russischer Sichtweisen auf die Welt ein Bruch mit 80 Jahren amerikanischer außenpolitischer Tradition.
Sind Trumps überzeugte Wähler*innen zufrieden mit ihm?
Besonders wenn die Zölle kommen, wird sich relativ schnell ein Umdenken zeigen. Die Auswirkungen sehen wir schon im Aktienmarkt – es wird sehr intensiv für die Bevölkerung werden: Große Verluste im Aktienmarkt bedeutet für viele große Verluste in der eigenen Rentenplanung, denn dort sind Renten investiert; die Inflation klettert jetzt schon wieder und wenn die Zölle im angekündigten Ausmaß kommen, könnten diese eine jährliche Teuerung von $4600 bei Familien der Mittelschicht und unteren Einkommensklassen bedeuten – ein ziemlicher Schlag. Vor dem 2. April schienen aber diese möglichen Realitäten noch nicht richtig angekommen zu sein. Wir sehen diese Spaltung zwischen sehr enttäuschten unabhängigen Wählern und der unterstützenden Mehrheit der MAGA-Republikanern, von denen acht von zehn in Umfragen angeben, sie fänden es gut, wie Trump mit einer gewissen Schnelligkeit „durchgreift“ – damals noch bezogen auf die Kürzungen von DOGE und über 100 Präsidentschaftsdekreten, die Wahlversprechen umzusetzen schienen
Sind denn überhaupt noch Menschen in Spitzenpositionen der Republikanischen Partei übrig, die der Make-America-Great-Again-Bewegung kritisch gegenüberstehen?
Wir sehen in den Aussagen einiger Kongressmitglieder durchaus Widerspruch und Kritik, wenn aber abgestimmt wird, wie beispielsweise beim Haushaltsplan der Republikaner, dann nehmen sich auch kritische republikanische Stimmen zurück. Das liegt zum einen an der finanziellen Drohkapazität für kommende Vorwahlkämpfe, in denen finanzstarke Spender, u.a. Musk und Co. sich einbringen wollen – im Sinne der Präsidentschaftsagenda. Zum anderen werden Abgeordnete physisch auf der Straße und durch Swatting-Attacks bedroht – die Kriminalstatistik allein in Washington ist seit Dezember in die Höhe geschnellt – besonders bezogen auf politische Figuren. Die Abgeordneten mit konträren Meinungen sind eingeschüchtert und in der Summe hat das zu einheitlichem Abstimmungsverhalten geführt. Die Zölle aber treten auch in der Bevölkerung eine solche Protestwelle los, dass sich auch in der Partei mehr Widerstand regt. Bei der vermeintlichen Durchsetzung des Haushalts wird man sehen können, wie bereit Republikaner sind, sich von ihrem Präsidenten loszusagen und andere Meinungen zu vertreten
Der Kongress und seine zwei Kammern sind mehrheitlich republikanisch. Wird Trump durchregieren?
Elon Musk hat weit mehr als 200 Millionen in den Wahlkampf gespült, um dafür zu sorgen, dass sich diese Kongressmehrheit für Trump ergeben hat. Veränderungen im Wahlsystem in großer Masse und in allen Staaten sind vorstellbar, aber nur indem die Macht des Kongresses genutzt wird, um zentrale Weichenstellungen zu verschieben. Wenn man sich beispielsweise das „Project 2025“ oder ähnliche Institutionen anschaut, dann kann man herauslesen, dass die Strukturveränderungen weitergehen sollen und das durchaus können.
Die Wahlrechtsreform, die gerade diskutiert wird, ist ein Präzedenzfall: Im Kongress kann sie so nicht durchkommen – nationales Wahlrecht braucht überparteiliche Mehrheiten, um verändert zu werden. So hat der Präsident mit einem Dekret „nachgeholfen“ um den Vorschlag der Republikaner, eine Ausweispflicht einzuführen, zu verstärken – auch das wird nicht durchkommen, weil ein Dekret dazu nicht das richtige legislative Mittel ist – aber, es dient zum Druckaufbau auf die Gouverneure. Und wenn solche Dinge zusätzlich zum Druck auf die republikanischen Gouverneure passieren, könnte das natürlich kumulativ dafür sorgen, dass das Wahlrecht nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte und Bevölkerungsgruppen entmachtet werden.
Wie steht es um die Gewaltenteilung in den USA?
In Teilen wird sie auf jeden Fall unwirksam. Die Trump-Regierung setzt die Kontrollkapazitäten des Kongresses aus, beispielsweise bei der Kürzung der Ukrainehilfe, und widersetzt sich gegen richterliche Anordnung, wie zum Beispiel bei den Massendeportationen nach El Salvador. Wenn Systeme technologisch zur Manipulation freigegeben werden und Musk – und nicht der Kongress – als Gatekeeper agiert, kann das zum Verhängnis werden. Durch DOGE [„Effizienzbehörde“ unter Leitung des Tech-Milliardärs Musk, Department Of Government Efficiency; A.d.R.] gibt es jetzt für jede Behörde neue Ziele, diese durch massiven Personalabbau und interne Kontrolle zu schwächen – vorbei an regulären Kontrollinstanzen. Das soll Sendungswirkung haben. In Summe geht es darum, die Rolle des Präsidenten im System zu erhöhen – das war nie die Intention der amerikanischen Verfassungsväter.
Sie haben in einem Interview gesagt, Trump habe sein emotional aufgeladenes Verhalten im TV gelernt. Ist das eine Schwäche, die genutzt werden könnte oder eine Stärke, die sich europäische Politiker*innen ein Stück weit aneignen können oder sollten?
Donald Trump interessieren keine Staatssysteme, ihn interessiert die Außenwirkung und persönliche Beziehungen. Man muss sich deshalb in diese Perspektive hineinversetzen, was viele europäische Politiker*innen allerdings geradezu anwidert. Dennoch tun sich innenpolitische Schwachstellen für Trump auf. Er wird europäische Staatschefs als Verlierer und sich als Gewinner sehen wollen, er sieht sich als König und verlangt entsprechende Tribute. Wenn man mit Trump verhandelt, muss man – auch um eigene Erfolge zu platzieren – planen, wie man die eigenen Ambitionen so verpackt, dass Trump sie trotzdem als Gewinne verkaufen kann. Diese Sorte transaktionalistisch-gedachter Diplomatie ist europäischen Staatschefs fremdgeworden. Kanada und Mexiko haben sich sehr lernfähig gezeigt – auch hier sollte man international Taktiken abgleichen.
Donald Trump wird innenpolitisch unter Druck kommen. Wenn es Möglichkeiten gibt, seine innenpolitischen Schwierigkeiten abzumildern und gleichzeitig für europäischen Wertzuwachs zu sorgen, ohne für Trump Partei zu ergreifen, wäre das ein strategischer Gewinn für die Europäer. Das setzt gute Diagnostik in Brüssel und in Europas-Hauptstädten voraus, die koordiniert und sequenziert werden muss, um Botschaften diplomatisch und medial gut zu platzieren.
Kann das nicht auch gefährlich sein und ihn noch mächtiger machen?
Natürlich muss man aufpassen, dass man sich dadurch nicht selbst konterkariert und Trump in seinem imperialistischen Gehabe bestärkt. Wenn man auf bestimmte Entscheidungen eingehen kann, um andere Dinge wieder erleichtern zu können, wäre das eine funktionale Strategie. Das einzige Problem an dieser Taktik ist die Erratik, die Trump zum Programm machen will. Er liest keine Sicherheitsbriefings, er entscheidet so. Clüver Ashbrook macht eine abrupte, ausladende Geste. Das könnte auch eine ausgeklügelte Strategie torpedieren.
Welche innenpolitischen Schwierigkeiten wird Trump genau bekommen?
Er wird Probleme mit amerikanischen Unternehmern und Investoren, aber auch mit seinen Kernwählern bekommen haben. Investoren brauchen Planbarkeit und gute Zielsetzung – das ist bei der jetzigen, konterkarierenden Zollpolitik nicht zu erkennen.
Ist Durchhalten bis zur nächsten Wahl eine Option für die Europäer*innen? Auf einen Demokraten nach Trump zu hoffen?
Nein. Die verheerenden Folgen des Umbaus in der amerikanischen Demokratie zwingen uns jetzt schon, andere internationale Beziehungen zu verstärken. Es muss nun darum gehen, den Abbau der internationalen Rechtsordnung einzudämmen, so z.B. in die Entwicklungspolitik aktiver zu investieren, denn China expandiert bereits seinen Einfluss im globalen Süden. Es gilt auch, neue Handelspartnerschaften aufzubauen und die existierenden zu erweitern oder in die Umsetzung zu bringen, wie die Handelsabkommen mit MERCOSUR, mit Japan und anderen Partnern. Innenpolitisch muss eine neue Bundesregierung Sachzwänge klar darstellen, mit den USA sachlich und aufgeklärt-realitisch umgehen.
Die Unterstützung antidemokratischer, aber auch pro-russischer Parteien wie der AfD torpediert in gewisser Weise einen stabileren Ausbau und Investition in die Sicherheitspolitik. Hatten Unterstützende wie Vance oder Musk das im Blick?
Momentan glaube ich, dass das noch nicht ganz verbunden wird. Aber die AfD ändert auch ihren Sprachduktus. Auf einmal sind die USA gar nicht mehr der größte Feind. Je nach Entwicklungen, wird das auch Anpassungen in der Haltung der AfD mit sich bringen.
Was war Ihr Gedanke zum KI-Post von Trump, dem „Trump-Gaza“-Videoclip? Wird global in den nächsten Jahren ein Umbau hin zu imperialistischen Bestrebungen vieler Akteur*innen stattfinden?
Ich fand es menschenverachtend, es glorifiziert eine Völkervertreibung und zeigt die völlige Weltentfremdung Trumps und die Parteinahme von bestimmten politischen Bestrebungen in Israel. Die Zweistaatenlösungen scheint vom Tisch, es geht hier um eine Veränderung der Regeln, die wir 1945 [gemeint ist die Gründung der Vereinten Nationen mit der UN-Charta, die die Souveränität von Staaten beschloss; A.d.R.] festgelegt haben – und das Video zeigt eine um eine Kommerzialisierung israelischen und palästinensischen Leids.
Menschen zeigen sich schockiert über diese Vorstoß, selbst überzeugte Wähler*innen sind entsetzt. Wie ernst darf man Trumps Ankündigungen nehmen?
Das ist einfach ein Werkzeug, das er immer wieder benutzt. Er hat aus dem Reality-TV gelernt: Wenn man Dinge in den Raum stellt, dann kann man neue Realitäten schaffen oder Dinge infrage stellen und dann ist es irrelevant, ob außenpolitisch so viel davon realisiert wird. Trump nährt sich am Normenbruch. Vieles davon ist unrealistisch, mit Recht und Gesetz nicht vereinbar, aber die Provokation stellt neue Dinge in den Raum, siehe auch die Ankündigungen zu Grönland, Panama und Kanada. Erst wird provoziert, dann wird die Umsetzung geprüft – Teil seiner zirkusartigen Strategie zum Teil abzulenken, von tatsächlichen Problemen, aber auch der Beginn, getragen von amerikanischer Macht neue Wahrnehmungen zu schaffen.
Was aber kann Europa nun tun, wie mitmachen, wenn man nicht mit den gleichen Mitteln spielen will?
Dieser Wettlauf um bestimmte Teile der Welt war die Idee, von der wir nach den Weltkriegen wegkommen wollten. Die Gründung der UNO und die Fassung internationalen Rechst sollte die Machtpolitik um Einflussgebiete endgültig abschaffen. Jetzt kehren wir an diesen Ausgangspunkt zurück: Großmächte [China, USA, Russland; A.d.R.] wollen ihre Einflussbereiche abstecken, das Recht des Stärkeren gegeneinander ausspielen. Die EU muss sich mit anderen etablierten Demokratien wie Japan, Südkorea, Australien, Indien oder Neuseeland zusammen tun. Diese Situation ist brandgefährlich.
Außer Musk und Mark Zuckerberg in den sozialen Medien, gibt es auch in klassischen Medien Trump-Unterstützer*innen. Nicht nur Jeff Bezos dient Trump mit der neuerdings so zugewandten Haltung seiner Washington Post. Welche Verantwortung tragen auch deutsche Journalist*innen und Medienhäuser weltweit, wenn es um Aufmerksamkeit für Trump geht?
Ich glaube, es gibt eine große Not an gut gemachtem investigativem Journalismus. Die Strategie, die Trump benutzt ist für Autokraten gängig. Trump-Berater Steve Bannon nannte sie einst “flooding the zone”: In einer enormen Geschwindigkeit werden so viele Ereignisse erzeugt, dass sich das System selbst betäubt und die gestandene Journalistenzunft nicht mehr hinterherkommt. Dem entgegensetzen kann man nur Qualitätsjournalismus. Die Besitzer der großen Sender – die in vielen Bereichen investiert sind, die unternehmerisch handeln wollen – kommen einander jetzt in vorauseilendem Gehorsam gegenseitig zuvor. Beispielsweise hat ABC News in einem Gerichtsprozess eine außergerichtliche Einigung angestrebt, obwohl sie auf einer juristischen Ebene die deutlich besseren Chancen hätten.
Das liegt dann daran, dass sie Angst vor Sanktionen haben und die Trump-Regierung damit droht, gegen die unternehmerischen Interessen von Medieneignern vorzugehen. Auch bei CBS haben wir diese Einschüchterungsklagen gesehen – die Redstone Familie, denen CBS gehört, stand gerade vor einer großen Merger-Entscheidung, in der die Regierung involviert war. Für Korrespondenten und internationale Journalisten gilt es, die Systemik Trumps in dieser zweiten Amtszeit zu verdeutlichen, besonders auch auf die Akteure im Hintergrund und deren Absichten hinzuweisen – denn autokratisierende Staatsumbau der verläuft hinter den Eilmeldungen und dem Blitzlichtgewitter.
Hier gilt es, finanzielle Interessen und personellen Entscheidungen engmaschig nachzugehen, um das System aufzudecken und zu warnen, denn wenn wir eines gelernt haben sollten, ist das, dass radikalisierte Bewegungen derzeit stark die gleichen Regieanweisungen nutzen. Das haben wir in Ungarn und Polen gesehen, es überträgt sich in Frankreich und Italien und wird in den USA perfektioniert. Wähler in Deutschland müssen besonders wegen der historischen Verantwortung des Landes für schleichende und dann schnelle Demokratie-Zersetzung sensibilisiert werden – das können vor allem die Medien.
Vielen Dank für das Interview, Frau Clüver Ashbrook.
Sehr gern. Danke!
Das Gespräch fand am Dienstag, den 4. März statt. Vier Tage nach dem Eklat im Weißen Haus. Der Artikel ist im Rahmen der offenen Redaktion entstanden. Bei Fragen, Anregungen, Kritik und wenn ihr selbst mitmachen mögt, schreibt uns eine Mail an redaktion@jugendpresse.de