Die Nachfrage an psychiatrischen und psychotherapeutischen Gesundheitsleistungen wird immer höher. Oft kann sie nicht hinreichend abgedeckt werden. Auch viele junge Menschen sind betroffen und leiden unter einer gesamtgesellschaftlichen Stigmatisierung.

Generationenunterschiede
Die frühe Lebensphase bis zum Alter von 27 Jahren ist prägend: Auszug und Ausbildungsbeginn fallen in diese Zeit. Die hohe Dichte an prägenden Erlebnissen trägt jedoch dazu bei, dass junge Menschen anfälliger für psychische Erkrankungen sind. Genau wie körperliche Gesundheit hängt der Zugang zu mentaler Gesundheit mit Privilegien und Ressourcen zusammen. Auch der soziale Status hat Einfluss darauf, ob jemand sein Leben gesund führen kann.
Junge Menschen stehen heute durch einen erhöhten Leistungsdruck und ein digitalisiertes Zeitalter vor anderen Herausforderungen. Das nachzuvollziehen, kann vorherigen Generationen schwerfallen, hatten sie doch tendenziell weniger Optionen und materielle Möglichkeiten. Doch Krankheit entsteht mehrdimensional. Die Ursachen sind vielfältig.
Konkurrenzkampf in der Leistungsgesellschaft
Entscheidende Faktoren für mentale Gesundheit sind emotionale Unterstützung, finanzielle Mittel und ein persönliches Beziehungsnetzwerk. All dies erhöht oder senkt die Chancen, Träume zu verwirklichen und persönliche Fähigkeiten zu entwickeln. In einer sich dynamisch wandelnden Welt sieht sich die jüngere Generation zunehmend Zukunftsängsten wie der Klimakrise ausgesetzt. Gesellschaftlich leiden junge Menschen unter dem Druck, studieren zu müssen und sind immer häufiger in befristeten Arbeitsverhältnissen angestellt. Im Jahr 2018 waren Menschen unter 25 Jahren zu 46 Prozent häufiger von einer Befristung betroffen als ältere Arbeitnehmer*innen.
Durch den scheinbar ins unermessliche wachsenden Wettbewerb gibt es eine lange Liste an persönlichen Anforderungen, die in möglichst kurzer Zeit erfüllt werden müssen – der Lebenslauf soll vollgepackt sein von Auslandsaufenthalten, Sonderqualifikationen und sozialem Engagement.
Hinzu kommt der bei vielen seit dem Grundschulalter mitschwingende Gedanke, bewertet und kategorisiert zu werden. Gleichzeitig mindert Krankheit die Leistungsfähigkeit, Schüler*innen geraten in eine Abwärtsspirale. Dabei sind sie für die Gesellschaft eine wichtige Zukunftsressource. Schulen fördern kaum Gesundheitskompetenz, obwohl die Entstigmatisierung schon hier stattfinden könnte.
Im Wettbewerb finden sich junge Menschen auch im Internet – in einer durchs Influencertum befeuerten Scheinrealität und dem ständigen Vergleich mit anderen, was Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper schafft. Durch Kommentare und Beurteilungen anderer wird die eigene Person verzerrt wahrgenommen: Kinder und Jugendliche orientieren sich an ihren vermeintlichen Defiziten.
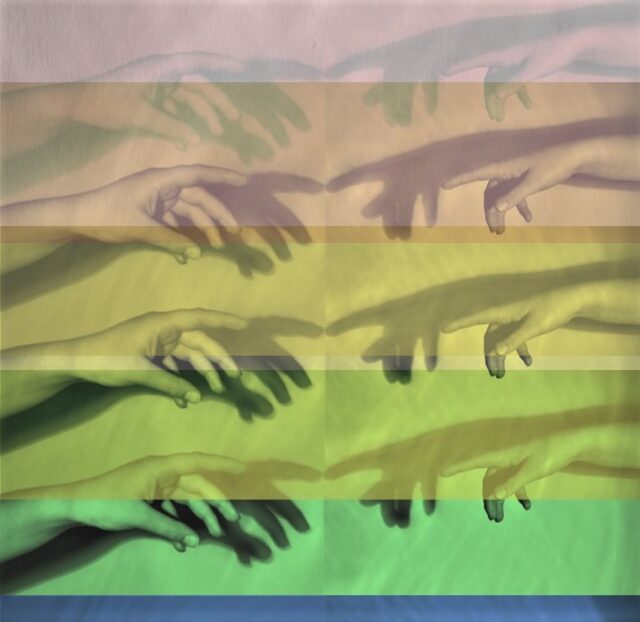
Gesundheit als Wertgegenstand
In jungen Lebensphasen sind viele Entscheidungen zu treffen: von der Berufs- bis hin zur Partner*innenwahl. Es herrscht ein großer Druck, sich richtig zu entscheiden. Einzelnen Entscheidungen wird ein großer Wert zugemessen und wenn „Zeit ist Geld“ gilt, darf vermeintlich keine Zeit für Irrwege verschwendet werden. Für die Pflege der eigenen Gesundheit muss Zeit in Anspruch genommen werden. Hierzu braucht es Strukturen, die junge Menschen als anfällig für psychische Erkrankungen anerkennen und ihnen eine umfangreiche Prävention und Gesundheitsversorgung bieten. Dafür müssen Angebote niedrigschwellig sein, beispielsweise sollen Betroffene sie ohne großen bürokratischen Aufwand in Anspruch nehmen können. Genauso müssen Termine in Fülle vorhanden und ohne teils monatelange Wartezeiten wahrnehmbar sein.
Im Gespräch wünscht sich AG-Teilnehmerin Lina einen offeneren Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit. Medien sollten Betroffene nicht pauschal als funktionsuntüchtig darstellen. Auch plädiert sie für gezieltere Präventionsmaßnahmen und zieht den Vergleich zum Zahnarzt: Schon früh bekommen wir gezeigt, wie man Zähne putzt und besuchen regelmäßig Vorsorgetermine – warum nicht schon frühe Aufklärungsmaßnahmen, wenn es um psychische Gesundheit geht?
