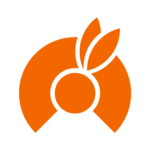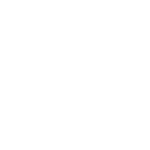Terrorgruppen wie der „Islamische Staat“ sorgen in der Welt für viel Aufruhr. Sie verbreiten Schrecken mit ihren Angriffen, bei denen viele Menschen zu Schaden kommen. Oftmals sind die Täter junge Menschen auf die der IS anziehend wirkt. Wie kommt es zu dieser religiösen Radikalisierung gerade Jugendlicher? Wie kann man dem vorbeugen und was hat das mit Vertrauenslehrern an deutschen Schulen zu tun?

„Warum radikalisieren sich junge Muslime?“ Diese Frage stellen sich 6 junge Menschen in einer Arbeitsgruppe im Rahmen der JPT17 in Berlin. Zum zweiten Tag der Veranstaltung finden sie sich in der Saarländischen Landesvertretung zusammen. Das Oberthema ist die Radikalisierung im Kontext der Religion. Das Gespräch beginnt zögerlich. Am Tisch sitzen zwei junge Musliminnen und es wirkt zunächst so, als ob sich niemand die Finger verbrennen will. Das merken die beiden jedoch schnell. „Es ist doch vollkommen klar, dass wir nicht über den Islam reden, sondern über Islamismus!“, lenkt Hibba (17) ein. Damit ist das Eis gebrochen und die aufgelockerte Stimmung ist gleich zu spüren. Nur wenig später entsteht eine hitzige Diskussion zwischen den Teilnehmenden.
„Sie denken, sie tun das Richtige“
Den Anfang macht aber eine ganz andere Frage. Denn die Gruppe muss herausfinden, welche biographischen und gesellschaftlichen Faktoren für eine Radikalisierung entscheidend sind. Adam (19) stellt fest: „Es haben doch alle Extremisten eine ähnliche Biographie.“ Das scheint den Rest zu inspirieren, denn jetzt bricht ein regelrechtes Ideengewitter in der Saarländischen Landesvertretung aus. Stichworte wie „Armut“ und „geringes Selbstbewusstsein“ fallen. Oftmals fühlten sich die Radikalen ausgeschlossen und nicht akzeptiert. Sie würden nach einem familiären Umfeld suchen und bräuchten Halt, wie Fatma (24) sagt. „Sie wollen Teil eines Systems sein – dazugehören“, führt sie weiter aus. Bald haben die angehenden Politiker ein großes Repertoire an Ursachen gesammelt.
Sie streiten sich weitere drei Stunden. Die Meinungen gehen an einer Stelle auseinander und finden an anderer wieder zusammen. Doch so dramatisch sich die Diskussion manchmal zuspitzt, alles geschieht auf Augenhöhe – die Teilnehmenden respektieren sich. Wer Prävention angehen möchte, muss jedoch auch die Beweggründe der Radikalen verstehen. Es kristallisiert sich heraus, dass das größte Problem wohl die Überzeugung sei. „Sie denken, sie tun das Richtige“, bedauert Fatma. Hibba erklärt sich das so: „Ihnen wird ein Leben nach dem Tod versprochen und das tröstet viele.“ Für den Glauben zu sterben würde den ehemaligen Außenseitern einen neuen Sinn in ihrem Leben geben. Dem haftet natürlich eine gewisse bittere Ironie an.
Verstanden und gehört
Als es in die letzte Runde geht, blickt man in erschöpfte Gesichter. Unzufrieden sieht aber keiner aus. Die Motivation hat noch nicht nachgelassen. Jetzt werden „Forderungen an die Bundesregierung“ gestellt, wie die Projektleiterin es nennt. Diese sollten es dann in der Theorie möglich machen, religiöser Radikalisierung vorzubeugen. Im ersten Vorschlag ist die Rede von Fortbildungen für Lehrer. Dienste wie Vertrauenslehrer gäbe es zwar schon an vielen Schulen, aber wenige Betroffene würden sich tatsächlich trauen, diese in Anspruch zu nehmen. Die Initiative müssten die Lehrer ergreifen, um den Schülern mehr entgegenzukommen. Fortbildungen, in denen die Lehrer mehr über die Traditionen des Islams erfahren, müssten regelmäßige Pflicht sein. Außerdem sei es wichtig nicht nur christlichen Religionsunterricht anzubieten, sondern einen vielschichtigen Ethikunterricht. „Junge Muslime sollen sich nicht mehr ausgeschlossen fühlen.“, resümiert Adam. „Sie wollen auch verstanden und gehört werden.“

„Ein Tag, eine Religion“
Die wohl ausgefallenste Idee hat aber Fatma. Sie träumt von einem „Haus der Religionen“. Dies solle ein Ort sein, eingerichtet durch die Regierung, in dem praktisch alle Gotteshäuser aufeinandertreffen. Auf den ersten Blick klingt das ganze recht utopisch, aber die junge Muslimin hat sehr konkrete Vorstellungen. „Christen, Juden und Muslime haben doch alle andere Feiertage in der Woche.“, leitet sie ein. „Sonntags kommen halt die Christen in das Haus, um zu beten und Gott nah zu sein. Am Samstag können das die Juden tun und freitags sind die Muslime dran.“ Ihrer Meinung nach könne man so ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den Religionen herstellen. Ein gemeinsamer Ort an dem man seinen Glauben auslebe, könne verbinden. Aufklärungsbedarf bestehe auf allen Seiten. Das sei das Wichtigste. So bedauert sie: „Der Islam wird so missverstanden von den meisten Deutschen. Viele wissen zum Beispiel immer noch nicht, warum ich ein Kopftuch trage.“ Beim Tragen eines Kopftuches möchte sich Fatma nämlich von einer oberflächlichen Gesellschaft distanzieren. Es gehe dabei um die Persönlichkeit und die Intelligenz, die eine Frau ausmachen sollten und nicht ihr Aussehen. Durch ihr „Haus der Religionen“ verspricht sie sich besseres Verständnis unter den Glaubensrichtungen. Aufklärung sei die beste Möglichkeit, um einer Radikalisierung vorzubeugen. Alle müssten verstehen, dass wir keine Feinde sind, nur weil wir in andere Richtungen denken. Da denkt Fatma in die richtige Richtung, pflichtet ihre Arbeitsgruppe ihr bei.