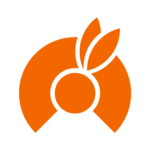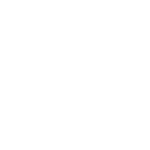Diamorphin ist reines Heroin. In Substitutionambulanzen wird dieses Abhängigkeitserkrankten kontrolliert verabreicht. Wie das funktioniert, hat sich politikorange-Redakteur Lukas Hinz in der Asklepios Substitutionsambulanz Hamburg-Altona angeschaut.

Diamorphin hat eine stark schmerzstillende Wirkung. Bei sachgerechtem Konsum beschädigt das reine Heroin erstaunlicherweise weder Niere, Leber oder das Knochenmark. Was dagegen relativ schnell eintritt: eine psychische und körperliche Abhängigkeit. Daher sind die Hürden, um an eine kontrollierte Diamorphinabgabe zu gelangen, relativ hoch: Bekommen kann es, wer über 23 Jahre alt ist, bereits fünf Jahre lang nachweislich opiatabhängig ist, unter körperlichen oder psychischen Begleiterkrankungen leidet, welche durch die Einnahme verschuldet sind, und mindestens zwei erfolglose Therapien hinter sich hat.
Ein ganz normaler Tag
Als ich in die Hamburger Diamorphinambulanz komme, werde ich freundlich von der Praxismitarbeiterin Bettina* begrüßt. Sie sitzt an der Anmeldung und organisiert den „Check-In“ der Patient*innen. Diese machen an der Anmeldung einen kurzen Atem-Alkoholtest und erhalten dann ihre Wartenummer. Eigentlich läuft alles nach Plan. Doch dann kommt da dieser eine Patient und tritt an die Anmeldung. Er wird mir dauerhaft in Erinnerung bleiben, denn er soll kein Diamorphin, sondern Methadon erhalten. Doch es gibt ein Problem, denn er ist zu früh. Er erklärt Bettina, dass er jetzt einen Job hat und deshalb früher zur Ausgabe kommen müsse, damit er pünktlich bei der Arbeit sei.
An sich sei das auch ganz okay, erklärt mir Bettina: „Der Patient muss einen entsprechenden Nachweis mitbringen, sei es eine Bescheinigung des*der Arbeitgebers*in oder den Arbeitsvertrag.“ Das sehe das Hygiene-Konzept der Substitutionsambulanz vor, da Substituierte per se als Hochrisikopatient*innen gelten. Zwecks Infektionsschutz erhalten die Patient*innen hier deshalb verschiedene Ausgabezeiten.
Ich begleite Bettina weiter und schaue mir alles genau an. Läuft alles nach Plan, erklärt sie mir, dürfen die Patient*innen nach erfolgter Registrierung in den Warteraum. Sobald ihre Nummer auf dem Display erscheint, geht es in den sogenannten Applikationsraum. Bevor ich dort eintrete, begegnet mir wieder der Patient von vorhin. Bettina erklärt ihm nochmal, dass er erst um 9:30 Uhr zur Methadon-Ausgabe kommen darf und macht einen Eintrag in seine Patient*innen-Akte. Er ist wiederholt zu früh in die Ambulanz gekommen und hat keinen Nachweis vorgelegt, dass er früher kommen muss. Das wird hier als Fehlverhalten gewertet. Nun beobachte ich Bettina, wie sie seine Verstöße einträgt. Das muss sie machen, damit die Kolleg*innen „im Ernstfall“ Bescheid wissen.
Warten bis zur „Straßentauglichkeit“
Nach und nach kommen immer mehr Menschen zur Anmeldung und auch die Belegschaft des Applikationsraumes ändert sich fast minütlich. Bettina bringt mich dorthin. Hier wird den opiatabhängigen Menschen Heroin in reiner Diamorphinform ausgegeben. Nicht nur das. Im Applikationsraum erhalten die Patient*innen auch benötigte Begleitmedikamente wie Blutdruckmittel, wenn sie nicht in der Lage sind, an die regelmäßige Einnahme zu denken.
Direkt stechen mir die Praxismitarbeiterinnen Susanne* und Louisa* ins Auge: Sie händigen gerade eine Spritze an die Patient*innen aus. Bei der Verabreichung bin ich jedoch nicht dabei. Etwas Privatsphäre soll immerhin gewährleistet werden. Aber, nur etwas. Denn Susanne sitzt hinter einer Plexiglas-Scheibe und beobachtet die Patient*innen kontinuierlich während der Applikation, um die sichere Vergabe zu gewährleisten und ein Herausschmuggeln des Diamorphins zu verhindern. Ich beobachte sie kurz, irgendwie fühlt sich das doch etwas seltsam an. Ein Mann liegt auf einer Liege, er hat sich das Diamorphin in den Oberschenkel gespritzt und eine Position eingenommen, die etwas seltsam und verkrampft auf mich wirkt. Er verharrt kurz in dieser Pose und bleibt dann liegen. Susanne, die das Geschehen stets im Griff zu haben scheint, reagiert blitzschnell und bittet ihn, sich langsam wieder fertig zu machen. Langes Verweilen ist aus aktuellem Anlass – ganz im Zeichen der Corona-Pandemie – nicht so gern gesehen.

Susanne zückt ein kleines Kärtchen, auf dem sein Name und eine Uhrzeit steht. Das drückt sie ihm in die Hand und erklärt, damit solle er sich in die Anmeldezone setzen. Gehen darf er, sobald die Zeit, die auf der Karte steht, vorüber ist. Susanne erklärt: „Das ist die Zeit, zu der er wieder straßentauglich sein sollte“. Straßentauglich sein, das kenne ich vom Autofahren. Aber als Begriff dafür, wann es nach einer kontrollierten Medikamentenabgabe in einer Arztpraxis zumutbar ist, wieder zu gehen – das ist mir neu. Normalerweise sind die Patient*innen deutlich länger in der Ambulanz anzutreffen, erklärt mir die Oberärztin später. Wie lange die Patient*innen in der Ambulanz bleiben, hängt vom pharmakologischen Halbzeitwert und der tagesformabhängigen Verträglichkeit des Medikamentes ab.
Nach der Diamorphinausgabe reinigt Susanne den Applikationsraum. Gerade während der Corona-Pandemie muss hier noch mehr auf die Hygiene geachtet werden als sonst.
Währenddessen geht die Ausgabe von Methadon und Polamidon weiter. Hier sitzt Lydia. Sie kennt die Patient*innen, die täglich kommen – sehr gut sogar. Mittlerweile hat sie die meisten Namen drauf. Sie ruft im Rechner die Personen auf, schaut nochmal, ob irgendwelche Bemerkungen in der Patient*innen-Akte sind und fragt noch einmal nach der Dosis.

„Einmal Methadon bitte!“
Wenn alles passt, klickt sie am Bildschirm auf „Medikament ausgeben“. Und schon wird das Methadon in eine Plastikschale gepumpt. Darin befindet sich bereits in etwas Wasser gelöster Waldmeister-Sirup. Louisa, die die Ausgabe aus dem Hintergrund beobachtet, erklärt mir, warum Methadon mit Waldmeistersirup gemischt wird: „Das Methadon wird hier mit Waldmeistersirup und Wasser versetzt, um das Herausschmuggeln, das Spritzen oder die Weitergabe des Wirkstoffs zu verhindern.“ Außerdem besteht laut Louisa eine gesetzliche Pflicht, orale Substitute in solcher Form zu vergeben, dass sie nicht intravenös gespritzt werden könnten.
Danach beobachte ich, wie ein Patient eine Urinprobe abgeben muss. Lydia, ebenfalls Mitarbeiterin der Praxis, gibt ihm einen Becher und er verlässt die Ausgabe in Richtung der Herren-Toilette. Ich bin etwas überrascht, doch Lydia erklärt mir den Hintergrund: „Wir überprüfen regelmäßig, ob die Patient*innen einen Nebenkonsum von anderen Drogen, wie Cannabis oder andere Substanzen haben.“
Nebenbei bereitet ein Kollege im Raum nebenan die Spritzen für die nächste Diamorphinausgabe vor. Hier sitzt Nils, er ist gerade dabei die letzten Spritzen aufzuziehen. Er erklärt mir, dass alle Empfänger*innen , die in der Patient*innen-Akte eingetragene Menge in eine Spritze aufgezogen bekommen und diese dann mit dem jeweiligen Namen versehen wird.
Es geht nicht nur um den Stoff
In seltenen Fällen kann nach der Applikation eine Atemdepression oder ein Krampfanfall ausgelöst werden. Sobald das passiert, werden die Patient*innen in einen Notfall-Raum gebracht – dort wird Sauerstoff und ggf. ein Antidot (Anm. d. Red: Ein Gegenmittel) verabreicht. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, ist diese Person das Hauptmerk Nummer 1 der diensthabenden Ärzt*innen und wird vor der nächsten Ausgabe noch einmal gründlich durchgecheckt. Gegebenenfalls wird die Dosis dann für das nächste Mal auch reduziert.
Doch nicht nur das Verabreichen der Substanzen Diamorphin, Methadon oder Polamidon ist Teil der Behandlung, sondern auch die psychosoziale Betreuung der Patient*innen. Christoph* und Markus*, die beiden Sozialarbeiter sind hier die Ansprechpartner für alle Patient*innen.
Durch einen individuell angepassten Betreuungsplan unterstützen sie die Patient*innen zum Beispiel bei der Suche nach einem Wohnsitz, vermitteln Therapien oder helfen bei Terminen vor Ämtern, Gerichten und anderen Einrichtungen sowie beim Wiedereinstieg in Schule, Arbeit oder Ausbildung. In der ASKLEPIOS-Substitutionsambulanz hat man ebenfalls eine Kooperation mit dem Verein Jugend hilft Jugend Hamburg e.V., der mit zwei erfahrenen Sozialarbeiter*innen bei allen Sachen unterstützt.
Mein Besuch in der Substitutionsambulanz hinterlässt mich nachdenklich. Ich stelle fest, dass unsere Gesellschaft Drogenkonsument*innen viel zu stark „abstempelt“ – schließlich sind es nur Menschen, die Drogen konsumieren. Genau dieser Konsum wird krass stigmatisiert, während Alkohol zu trinken oder Rauchen gesellschaftlich akzeptiert wird.
Es ist zu einfach zu sagen, dass Menschen an diesem Ort Drogen verabreicht werden. Stattdessen wird hier Menschen geholfen: in ein geregeltes Leben, frei von Beschaffungskriminalität und dem ständigen Verlangen, die Sucht zu befriedigen. Dazu wird diesen Menschen ein Medikament verabreicht. Ich lasse den Tag nochmal Revue passieren und denke: Dafür sollte die Abgabe schon vereinfacht werden. Doch solange das Stigma der Menschen nicht weicht, bin ich mir sicher, dass sich auch unsere Drogenpolitik nicht so schnell verändern wird.
* Hinweis der Redaktion: Die Namen der beteiligten Personen wurden geändert.