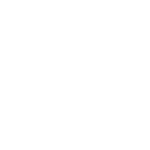Rechtsextreme Gewalt nimmt zu und die AfD bekommt immer mehr Zustimmung in den Umfragen. Zugleich werden Zeitzeug*innen des Nationalsozialismus immer älter und sterben. Wie kann in Deutschland Erinnerungskultur weiter stattfinden? Das politikorange-Redaktionsteam ist dieser Frage ein Wochenende lang in Berlin nachgegangen.

Das politikorange-Redaktionsteam setzte sich vom 24. bis 27. April unter der Leitfrage „Was bedeutet es, in den aktuellen Zeiten ‚Nie wieder!‘ zu proklamieren?“ mit dem Themenkomplex Erinnerungskultur auseinander.
Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht und besiegelte damit das Ende der NS-Herrschaft. 80 Jahre später ist dieses Datum in Berlin nun ein Feiertag.
Doch der Umgang mit Erinnerungskultur verändert sich und auch offiziell etablierte erinnerungspolitische Positionen werden zunehmend in Frage gestellt. So befürwortet mittlerweile mehr als die Hälfte der im Rahmen einer policy matters-Studie befragten Deutschen, dass 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein „Schlussstrich unter die Vergangenheit des Nationalsozialismus” gezogen werden solle. Zugleich gibt es immer weniger Zeitzeug*innen, die Verbrechen der NS-Zeit selbst miterlebt haben. Wie Erinnerungskultur in Zukunft stattfinden kann, muss auch deswegen neu verhandelt werden.
Zu diesem Anlass sprach die politikorange-Redaktion in Berlin mit Expert*innen und Passant*innen, besuchte Gedenkstätten, Museen und Theater. Entstanden sind (Video-)Beiträge, die das Thema Erinnerungskultur aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Der 8. Mai als „Tag der Befreiung” sollte als Feiertag primär denjenigen Menschen gedenken, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet worden sind. Aber es ist auch eine Geschichte der Mehrheit der Deutschen, die als Täter*innen und Mitläufer*innen die NS-Diktatur gestützt haben. Politikorange-Redakteurin Johanna Glöe ging deswegen der Frage nach, wie mehr über die Vergangenheit der eigenen Familie im Nationalsozialismus herausgefunden werden kann und weshalb solche Nachforschungen auch heutzutage noch politisch sind.
Erinnerung wird auch aus der Perspektive derer vollzogen, die Opfer des NS-Terrors gewesen sind. Redaktionsmitglied Alma Jung war zu Besuch im Jüdischen Museum Berlin, wo sie mit Bildungsabteilungsleiterin Diana Dressel über die Erinnerungsarbeit des Museums gesprochen hat und Einblicke in die aktuelle Ausstellung gibt.
In Berlin erinnern zahlreiche Orte an die Zeit des Nationalsozialismus, darunter die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma oder das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Politikorange-Redakteurin Lotta Berendes-Pätz ist der Frage nachgegangen, inwiefern solche Orte Hilfe bei der Erinnerungsarbeit leisten. Alina Immken beschäftigt sich in ihrem Videobeitrag damit, ob Gedenkstätten sich auch in der Verantwortung dafür sehen, Bezüge zu unserer aktuellen politischen Situation herzustellen. Hannah Engel sprach unter anderem mit Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, über das Gedenken an den Holocaust und Prävention von Antisemitismus.
Erinnerungskultur hat sich mittlerweile auch ins Internet übertragen. Politische Bildungseinrichtungen oder private Accounts wie @keine.erinnerungskultur klären in den Sozialen Netzwerken über die NS-Zeit auf. Auf TikTok und Co. kursieren allerdings auch immer mehr falsche Fakten und Geschichtsverzerrung. Ob Social Media der richtige Ort für das Erinnern an den Nationalsozialismus ist, fragt sich Lenja Vogt. Xenia Bastert beschäftigt sich in ihrem Beitrag damit, wie Erinnerungskultur in diesen Zeiten neu gestaltet werden kann.
In Reels, YouTube-Beiträgen und Texten zeigt die Redaktion, auf welche unterschiedliche Weise Erinnerungskultur in Deutschland stattfindet und wie Gedenken und Erinnern hoffentlich auch in Zukunft noch bestehen können.
Die Beiträge der politikorange-Redaktion sind jetzt auf politikorange.de und bei Instagram @jugendpressede und YouTube @jugendpressede zu sehen.