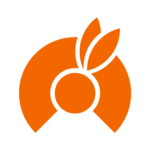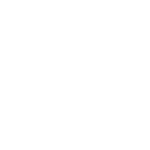Integration betrifft jeden Menschen in verschiedener Form. Menschliche Bewegung gab es schon immer und wird es auch immer geben. Jeder kann dazu beitragen, die Ankunft von Menschen zu erleichtern.

Der Begriff „Integration“ wird im tagesaktuellen sowie politischen Kontext fast inflationär genutzt und ist dennoch schwierig zu fassen. Laut Duden bezeichnet er die „Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“. Es kommen also viele unterschiedliche Identitäten zusammen. Doch auch wenn jeder Mensch beispielsweise Migration oder Flucht anders erlebt, lassen sich allgemeine Beobachtungen hinsichtlich der Alltagsrealitäten machen.
Zugehörigkeit und Teilhabe
Themen wie Identität, Bildung und Integration insbesondere zweiter Generationen widmet sich der Ethnologe Jens Schneider in seiner Forschung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Migration und Interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück und beschreibt Integration zunächst als ein Zusammenwirken von Zugehörigkeit und Teilhabe. Beides seien Zustände, die alle Lebenslagen durchziehen und – egal ob Kindergarten, Schule, Studium oder ein neuer Job – sie alle forderten von Menschen, sich in eine neue Umgebung zu integrieren.
Zwar sei Integration immer auch ein individuelles Bestreben, aber „all diese Bereiche haben Zugangsvoraussetzungen und ihre eigenen Regeln“, sagt Schneider. Er hinterfragt, wie gut die gesellschaftlichen Strukturen Integration ermöglichen. Das Zugehörigkeitsgefühl werde bei vielen durch die frühe Begegnung mit ausgliedernden Fragen wie „Was sagst du denn als Nicht-Deutscher dazu?“ oder „Wo kommst du denn her?“ eingeschränkt.
Wo ist das Problem?
Flucht oder Migration gehen mit einem Wunsch einher, die eigene Lebenssituation zu verbessern. Bei den Einwandererinnen oder Einwanderern erster Generation und den nachfolgenden Generationen, also ihren Kindern und Enkelkindern, gibt es nach Schneider jedoch wesentliche Unterschiede. Die erste Generation fokussiere sich auf die Bereiche Ankommen, Arbeiten und Wohnen und erhalte noch enge Bezüge zum Heimatland. Transnationale (Familien-)Beziehungen und eine gewisse Mobilität spielten dabei eine große Rolle. Die zweite Generation sei im Einwanderungsland zu Hause. Zwar bleibe man gegenüber den Eltern loyal, doch man hoffe auf Bildung, Erfolg und ein gutes Einkommen. Kulturen würden vermischt.
Die Teilhabe an der Gesellschaft sei für einige Personen dennoch strukturell erschwert. Auf die Frage, inwiefern denn Migration den Zugang zu Politik oder aber auch die Bildungs- und Karrierechancen beeinflusst, sagt Schneider: „Die Zahlen sind relativ deutlich. Anhand von quantitativen Studien sehen wir, dass wir viel weniger Mandatstragende mit Migrationshintergrund haben, dass Bildungsabschlüsse niedriger sind und auch beim Zugang zum Arbeitsmarkt gibt es Diskriminierung.“ Auch das deutsche Schulsystem, dass Schülerinnen oder Schüler früh nach Leistung teilt, erschwere vielen Kindern und Jugendlichen den gesellschaftlichen Aufstieg.
Migration als Normalzustand
Dabei sei ein Migrationshintergrund auf lange Sicht „keine relevante Kategorie mehr”. In Frankfurt am Main beispielsweise leben bis zu 50 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationsgeschichte. Allgemein ist Mobilität in einer globalisierten Gesellschaft vollkommen normal. „Irgendwann ist es wahrscheinlicher jemanden zu treffen, der einen Migrationshintergrund hat als jemanden, der keinen hat.“
Was ist also zu tun, um dieser unaufhaltbaren Entwicklung entgegen zu kommen?
Viele Konzepte setzen früh an. Die Schule, aber auch schon die Kita oder der Kindergarten sind Orte an denen durch geschickte Zusammenführung unterschiedlicher Kinder eine inklusive Gesellschaft geschaffen werden kann, die die Bedürfnisse von Kindern aus Migranten- und Geflüchtetenfamilien anerkennt.
Jeder kann mithelfen
Laut Viktoria Schuck, einer 18-jährigen Studentin der Volkswirtschaftslehre, führe beispielsweise eine Trennpolitik in Schulklassen zu eher negativen Ergebnissen. Als 2015 der große Strom an Geflüchteten in Deutschland ankam, begann sie in der Erstaufnahme in Regensburg Gruppen von bis zu 40 Menschen in Deutsch und Mathematik zu unterrichten. Mittlerweile arbeitet sie enger mit einzelnen zusammen. Schuck berichtet, dass eine geflüchtete Drittklässlerin, die in einer integrativen Schulklasse untergebracht wurde durch den alltäglichen Austausch mit ihren Mitschülerinnen oder Mitschülern schnell Fortschritte zeigte. Mittlerweile habe sie eine Gymnasialempfehlung erhalten.
„Wichtig für Jugendliche, die sich für Geflüchtete engagieren wollen, ist: Du brauchst überhaupt kein Vorwissen“. Offenheit, eine Sensibilität für Sprache und soziale Kompetenzen seien wichtige Hilfsmittel. Insgesamt sei es wichtig, auf Menschen zuzugehen, da wir alle voneinander lernen können.