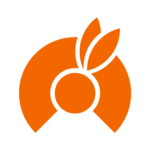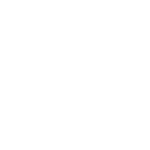Rassistische Entgleisungen, toxische Beziehungen, Mobbing: Reality-Formate von „Sommerhaus der Stars“ bis „Prominent getrennt“ setzen zunehmend auf immer neue Eskalationsstufen, um die Sendungen interessant zu halten. Geht das nicht auch anders? Ein Erkundungsversuch.

„Bewege deine Fresse aus der Kamera!“ schreit Desirée Nick Claudia Obert an und stößt sie ungestüm von sich weg. Reality-TV-Liebhaber*innen dürfte der kulthafte Streit der zwei Diven in der Sendung „Promis unter Palmen“ wohlbekannt sein. Was als heftiger, doch unterhaltsamer Streit zwischen zwei einigermaßen Ebenbürtigen begann, entwickelte sich in den weiteren Folgen der Sendung sehr schnell zu einer hässlichen Form des Mobbings und endete damit, dass Obert weinend auf dem Boden der Promi-Villa lag und das Format schließlich verließ. Die Grenze des gerade noch Sag-, Seh- und Ertragbaren, sie verschiebt sich zunehmend im Reality-TV.
Rassistische und sexistische Diskriminierungen, die unkommentierte Darstellung toxischer Beziehungsmodelle oder Mobbing sind dabei weder Einzelfälle noch Zufall. 2020 analysiert Claudia Krämer von der RWTH Aachen in ihrer Dissertation die Achtung der Menschenwürde im Reality-TV und stellt dabei fest, dass sich in den Formaten seit mehreren Jahren eine „Tendenz zu immer massiveren Grenzüberschreitungen“ beobachten lässt, von denen jede immer einen neuen, zweifelhaften Standard setze: Wer beispielsweise dachte, bei „Promis unter Palmen” könne es nicht noch menschenverachtender werden, dem wurde direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel eindrücklich das Gegenteil bewiesen, als Kandidat Prinz Marcus von Anhalt durch ekelhafteste homophobe Beleidigungen gegenüber DragQueen Katy Bähm auffällig wurde.
Als leidenschaftlicher Zuschauer von Reality-Formaten frage ich mich: Muss das sein? Geht es nicht auch anders, irgendwie harmonischer, unproblematischer und positiver?
Reality-TV reproduziert kapitalistische Erfolgslogiken
Wie die Utopie eines unproblematischen Reality-TV aussehen könnte, versucht Aktivistin und Schauspielerin Monika Freinberger im Produktionsteam des Kunstprojekts „TVWOW“ zu ergründen. In „Too Bougie To Handle“ werden hier beispielsweise analog zur Netflix-Show „Too Hot To Handle“ Logiken umgedreht, wie sie sagt. Während in dem Original vermeintlich bindungsunfähige, sexwütige Singles durch die strenge KI „Lana“ Enthaltsamkeit und wahre Liebe kennenlernen sollen, so sollen die Darsteller*innen in dem fiktiven TVWow-Format in einer postkapitalistischen Welt durch „richtig guten Sex“ lernen, ihre alten neoliberalen Denkmuster von Lästerei und Konkurrenz aufzugeben. Antikapitalistische Erziehung im SM-Studio quasi.

Denn Freinbergers Kritik an Reality-Formaten ist eine sehr fundamentale. Die Shows reproduzierten kapitalistische Erfolgslogiken, nach denen sich immer nur eine*r durchsetzen kann, was zu rücksichtslos konkurrierenden statt solidarisch agierenden Kandidat*innen führe: „Als Zuschauer lerne ich, dass alle Frauen zickig sind und sich gegenseitig hassen müssen. Ich lerne, dass es das Größte für mich ist, irgendwelchen Typen hinterherzurennen. Ich muss besser sein als die anderen, um zu gewinnen.“ Wer die Shows ändern wolle, müsse das System, in denen sie produziert werden, ändern.
„TVWOW” soll dabei als eine Art Spielwiese dienen für Ideen, wie es sein könnte: „Wir wollten das Fernsehen produzieren, was wir uns selbst am meisten wünschen würden.“ Ohne Diskriminierung, mit viel Queerness, Unterhaltung ohne schlechtes Gewissen – einfach mal ein bisschen in der Utopie rumspinnen.
Aber funktioniert das? Lebt Reality-TV nicht davon, auch mal bewusst unkorrekt zu sein, zu provozieren?
Braucht es die Klischees, die Provokation, die Eskalation?
Ramón Wagner, YouTube-Kommentator von und Casting-Agent für diverse Reality-Formate, meint ja, das brauche es: „Die Wahrheit ist halt auch, dass Langeweile niemand sehen will.“
Eine klare Grenze zieht er bei eindeutig diskriminierendem Verhalten und Handgreiflichkeiten. Bei Promis wie Prinz Marcus wisse man genau, wen man sich einlade und welche Art der „Unterhaltung“ man zu erwarten habe. Grenzüberschreitungen somit bewusst zu kalkulieren und sich anschließend als Sender halbherzig zu entschuldigen, das hält auch er für scheinheilig. Steigender öffentlicher Druck über beispielsweise Social Media sorgt jedoch maßgeblich dafür, dass die Sender es sich immer weniger leisten können, solche Vorfälle kommentarlos geschehen zu lassen. So berichtet Wagner, dass diskriminierende Ausfälle auch zunehmend in Verträgen der Shows aktiv verboten würden, was immer öfter dazu führe, dass Kandidat*innen konsequent von Shows ausgeschlossen werden (wie zum Beispiel Kandidatin Janina Youssefian nach einem rassistischen Kommentar im Dschungelcamp) und Übergriffe anschließend kritisch eingeordnet werden. Das zeigt auch, dass es sich als Zuschauer*innen lohnt, den Sendungen gegenüber kritisch zu bleiben und Veränderung einzufordern.
Doch ein generelles Auskommen ohne Klischees oder stereotypische Rollenbilder hält Wagner für unwahrscheinlich: „Reality-Shows sollen keine Vorbildfunktion haben, das ist nicht das Ziel der Sendungen und wenn es das Ziel werden sollte, dann wird es kein Reality mehr geben, weil die Leute es sich dann nicht mehr anschauen. Man guckt sich ja genau diese krassen Sendungen an, um sich vom Alltag abzulenken und sich in eine Welt zu beamen, in der man merkt, dass das eigene Leben eigentlich doch besser ist.“
Lästern als zusammenschweißendes Element
Damit liegt Wagner nicht ganz falsch. Forschungen zum Thema wie eine Studie zur Rezeptionswirkung der Sendungen von unter anderem der Medienwissenschaftlerin Dr. Laura Sūna zeigen, dass uns an den Shows vor allem ihre gemeinschaftsstärkende Funktion reizt. Wir tauschen uns besonders gerne mit anderen über die geschauten Shows aus, lästern und erheben uns gemeinsam über die dargestellten Kandidat*innen und können uns so unserer eigenen Gruppengrenzen vergewissern – sie nennt das soziale Distinktion: Was ist noch okay, was empfinden wir als peinlich, dumm oder grenzüberschreitend? Wie wollen wir selbst nicht sein im Gegensatz zu den Kandidat*innen?
Durch klischeehafte Darstellungen der Kandidat*innen kommen wir dann auch zu verallgemeinernden Bewertungen dieser Personen und der Gruppen, für die sie stehen: „Die Schwarze! […] Die hat die ganze Zeit immer richtig rumgejammert.“, meint eine der in der Studie befragten Zuschauer*innen. Sūna beschreibt den Einfluss von Klischees und problematischen Rollenbildern im Reality-TV als zirkulären Prozess: Als Zuschauer*in eigne man sich Wissen aus diesen Sendungen an und gebe dieses zum Beispiel auf dem Schulhof weiter. Vielleicht brauchen wir also gar nicht zwingend den schrulligen Schwulen oder die streitsüchtige, blonde Zicke um uns von Reality-TV unterhalten zu fühlen. Vielleicht sind wir durch die spezifische Machart der Sendungen bewusst darauf trainiert, solche Darstellungen als Unterhaltung zu empfinden.
Identifikation statt Distinktion? Mitfühlen statt Fremdschämen?
Was uns zurück zur Frage führt, ob es auch anders geht: Identifikation statt Distinktion. Mitfühlen mit emotionalen Geschichten der Kandidat*innen statt Fremdschämen für deren von den Produktionen teils bewusst provoziertes peinliches Verhalten. Formate wie „Prince oder Princess Charming” zeigen einen neuen Ansatz: Unterhaltung durch die Repräsentation von spannenden Charakteren und (queeren) Lebensformen, die sonst im Fernsehen eher nicht vorkommen. Ganz ohne Klischees und aufgebauschtes Drama geht es auch hier noch nicht, aber es ist ein Anfang. Es muss nicht gleich systemkritisches Bildungsfernsehen sein.
Wie Unterhaltung ohne Eskalation gelingen kann? Gute psychologische Betreuung am Set, Disclaimer zu dargestellten Stereotypen und kritische Einordnungen zu Übergriffen könnten die Shows schon ein bisschen weniger menschenverachtend gestalten. Ob das dann langweiliger ist, weil korrekter? Selbst Ramón Wagner findet: „Natürlich braucht es Reibungspunkte. Aber Reibungspunkte können ja auch hitzige Diskussionen auf Augenhöhe sein, ohne Beleidigungen oder körperliche Übergriffe.“
Warum Aktivistin Monika Freinberger trotz ihrer harschen Kritik dem Reality-TV treu bleibt? „Ich schaue mir die Leute einfach gerne an, ich finde sie lustig und sympathisch. Daraus kann man oft auch tolle Gesellschaftsanalysen ableiten.“ Und vielleicht liegt genau hier das Potenzial für künftige Shows. Wirklich vielfältige, interessante Protagonist*innen, die etwas zu erzählen haben und mit mehr unterhalten können als Beleidigung, Hass und Diskriminierung. Man wird wohl noch träumen dürfen.