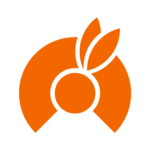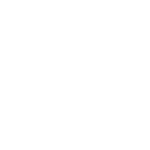Auf der Eine-Welt-Landeskonferenz hat Niklas Thoms den ehemaligen Militärattaché der Bundeswehr Wolf Kinzel interviewt. Der hat unter anderem sein Verständnis der „Vernetzten Sicherheit“ erklärt.

Wenn man mit Wolf Kinzel spricht, fallen Worte wie „Abschreckung“ „Stärke“ und „bekämpfen“. Wer Kinzels Vergangenheit betrachtet, wird sich darüber kaum wundern. Heute ist der einstige Militärattaché Referent der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, wünscht sich weniger deutsche Militäreinsätze und sagt, dass mit militärischer Gewalt immer nur Symptome bekämpft, nicht aber Frieden hergestellt werden kann. Wie kommt er zu solchen Aussagen?
Niklas Thoms: Herr Kinzel, Sie haben in Ihrem Vortrag erläutert, was Ihrer Meinung nach „Vernetzte Sicherheit“ bedeutet. Ich habe mich zur Vorbereitung auf dieses Interview natürlich auch mit diesen Definitionen auseinandergesetzt. Gänzlich kann ich mich der Kritik mancher NGO‘s nicht erwehren, wonach der Begriff unscharf und ein stringentes Konzept nicht immer erkennbar sei.
Wie definieren Sie denn den Begriff „Vernetzte Sicherheit“ für sich?
Kinzel: Für mich bedeutet „Vernetzte Sicherheit“ den planvollen, koordinierten und synergienutzenden Einsatz militärischer, ziviler, wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer und anderer Mittel und Kräfte. Das bedeutet, dass man die zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Werkzeuge so einsetzt, dass das Ergebnis der Zusammenarbeit am Ende besser ist als die Summe der Einzelteile – also das, was die einzelnen Akteure leisten könnten. Das ist der Teamgedanke dieses Konzepts, den ich als zentral empfinde. Man analysiert die bestehende Situation vor Ort und entscheidet dann, welche Instrumente benötigt werden und wie diese bei welchen Wechselwirkungen im Krisengebiet zum bestmöglichen Output beitragen können – das ist „Vernetzte Sicherheit“.
Die Vernetzung von welchen Akteuren und welchen Instrumenten meinen Sie konkret?
Kinzel: Militärische, zivile, wirtschaftliche, und entwicklungspolitische Instrumente und teilweise auch darüberhinausgehende Mittel und Kräfte. Das komplette Portfolio.
Wie kann man sich die Zusammenarbeit dieser Akteure konkret vorstellen?
Kinzel: Wie in einem Netz. Alle Akteure sollen miteinander verbunden sein. Es ist enorm wichtig, dass deutlich ist, wer welche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen besitzt. Stellen Sie sich das wie bei einem Werkzeugkasten vor. In einem Moment brauche ich dieses Werkzeug, aber schon im nächsten Moment kann sich die Situation ändern und dann brauche ich andere Werkzeuge. Und diese Werkzeuge und Akteure müssen miteinander kommunizieren. Das können Ortskräfte sein, oder internationale Organisationen, Streitkräfte anderer Nationen, die Vereinten Nationen oder das internationale Rote Kreuz und viele, viele mehr.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es schon ganz schlau ist, wenn man wechselseitig weiß, was der Andere tut und das Ganze planvoll zusammenführt und nicht dem Zufall überlässt.
Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass aus einem zufälligen Zusammenspiel in manchen Lebensbereichen etwas Gutes entstehen kann, dass dies in komplexen Krisensituationen aber nur selten zum besten Ergebnis führt.
Das bedeutet, das Ergebnis dieser Vernetzung kann auch oft so ausfallen, dass nur ein einziges Werkzeug zum Einsatz kommt, zum Beispiel nur das der humanitären Hilfe?
Kinzel: Natürlich! In vielen Situationen haben Streitkräfte gar nichts verloren, oder sie sind nur zeitweise da und ziehen sich dann wieder zurück. Ich denke allerdings, dass das Militär im Allgemeinen die Tendenz hat, in einer unübersichtlichen Krise vor Ort die Federführung zu übernehmen. Das kann auf zivile Partner mitunter einschüchternd wirken und eben sehr militärisch, daran sind wir nicht ganz unschuldig.
Sehen Sie, beim Militär stehen wir bei Krisen vor dem Problem, dass wir uns erstmal ein Bild von der Lage machen müssen. Oft ist diese sehr unklar. Wo ist das Problem? Welche Akteure sind vor Ort? Welche Interessen verfolgen sie? Welche Verluste oder Verletzte gibt es und wo? Unabhängig davon, ob es sich um ein Erdbeben, Völkermord oder einen Ausbruch von Überfallen handelt. Wir müssen zuerst genau wissen, was passiert ist. Wie ist die Lage vor Ort?
Und diese Erstellung eines Lagebildes ist nun einmal der erste Schritt einer jeden militärischen Aktion. Häufig hat keine andere Organisation die technischen Möglichkeiten dazu. Auch andere Akteure wie die Vereinten Nationen haben häufig keine eigenen Mittel, ein solches Lagebild zu erstellen.
Das heißt, wir müssen uns selber ein Bild machen. Und wenn wir dann vor Ort in Uniform, bewaffnet und mit militärischem Gerät auftauchen und in unserer klaren kurzen Befehlssprache versuchen die Initiative zu ergreifen, dann kann das auf einige Akteure einschüchternd wirken oder sie fühlen sich zur Seite gedrängt. Das verstehe ich gut.
Aber einen anderen Weg, um unter hohem Zeitdruck an gesicherte Informationen zu kommen, sehe ich oft nicht.
Nicht-staatliche Organisationen, die seit Jahren vor Ort sind, haben keine wertvollen Informationen?
Kinzel: Doch, natürlich! Wir versuchen immer auch im Rahmen von „civil-military cooperation“ genau diesen Informationsaustausch zu institutionalisieren.
Denn im Einsatz selbst darf man damit nicht erstmals anfangen, dann ist es oft schon zu spät. Wenn während eines Einsatzes beispielsweise in einem Überschwemmungsgebiet plötzlich festgestellt wird, dass die Rettungskräfte von Polizei Feuerwehr, THW und Bundeswehr aufgrund nicht kompatibler Funkgeräte nicht miteinander kommunizieren können, lässt sich das vor Ort kaum noch in den Griff bekommen. So etwas darf doch nicht passieren! Solche Szenarien muss ich vorher gemeinsam üben und solche Probleme vorher abstellen. Deswegen ist der „Vernetzte Ansatz“ so wichtig!
Welche Erfahrungen während Ihrer aktiven Zeit in Westafrika bestärken Sie besonders in der Verfolgung dieses Konzeptes?
Kinzel: Ebola! „UNMEER“ – das heißt ausgeschrieben „UN Mission for Ebola Emergency Response“! Das war für mich ein persönliches Erlebnis, wo zivile und militärische Bausteine in Teilen super ineinandergegriffen haben. Da bin ich zum Beispiel einfach zum Flughafen nach Ghana gefahren, zum Büro des dort ansässigen Lagers der Welthungerhilfe und habe an die Tür geklopft und gefragt, wer der Verantwortliche ist. Das anschließende Gespräch ergab, dass es großen Bedarf an Lufttransportkapazität zur Ausstattung der in den betroffenen Ländern einzurichtenden Behandlungszentren gab. Es fehlte an allem! Das deutsche Angebot, hier mit zwei Transall-Flugzeugen auszuhelfen, fand große Begeisterung. Letztendlich sind wir fast ein halbes Jahr lang mit zwei Flugzeugen täglich die Hauptstädte der drei von Ebola betroffenen Länder angeflogen und haben Hilfsmittel geliefert. Dort am Flughafen in Ghana ist dann übrigens auch quasi über Nacht das „UNMEER“-Hauptquartier entstanden.
Abgesehen davon, dass es über die Effizienz der Ebola-Hilfe sehr geteilte Meinungen gab, war bei diesem Einsatz zumindest die Zielsetzung der verschiedenen Akteure dieselbe.
Anders sieht dies oft in Krisen- und Kriegsgebieten aus. Sehen Sie kein Konfliktpotenzial bezüglich der verschiedenen Zielsetzung von humanitären, nicht-staatlichen Organisationen und staatlichen Akteuren wie dem Militär? Und was halten Sie der Kritik vieler NGO‘s entgegen, ihre Sicherheit würde dadurch gefährdet, dass sie als Teil einer Besatzungsmacht wahrgenommen würden?
Kinzel: Diesen Einwand verstehe ich gut. Gerade Entwicklungshelfer in schwierigen Sicherheitssituationen wollen oft nicht mit Soldaten in Verbindung gebracht werden, weil sie dadurch in Gefahr geraten können. Nicht durch die Soldaten selbst aber klar: Wenn du unbewaffnet bist, bist du darauf angewiesen, dass deine Umwelt dir wohlgesonnen ist und man dich nicht als Konfliktpartei wahrnimmt, als von außen eingreifender Akteur.
Aber letztendlich befürchte ich, dass du immer als „Außenstehender“ wahrgenommen wirst – das war zumindest meine Erfahrung, die ich in Westafrika gewonnen habe. Allein schon die Hautfarbe macht dich zumindest in Afrika immer irgendwie zu einer Partei. Zumindest aus der Wahrnehmung vieler Menschen vor Ort. Manche Gruppen sagen offen: „Ihr seid die Weißen“, „ihr wollt uns ausbeuten“ oder „ihr seid Kolonialisten!“ – und verdenken kann man ihnen das oft natürlich nicht.
Worauf ich hinaus will, ist, dass ich die Angst vieler NGO-Mitarbeiter, als Konfliktpartei wahrgenommen zu werden, verstehe. Aber ein Stück weit ist das eben auch einfach ein systemimmanentes Problem.
Aber mit dieser Problematik gehen NGO-Mitarbeiter doch seit Jahrzehnten um. Trotzdem haben sie auf das Konzept der „Vernetzten Sicherheit“ bezogen große Bedenken und fürchten vermehrt um ihre Sicherheit.
Kinzel: Ja, das kann ich nachvollziehen! Es gibt nun einmal diese Nebenwirkungen. Ich befürchte, dass es in dem Moment, wo man mit Streitkräften auch Gewalt ausübt, diese Nebeneffekte immer gibt, auch wenn wir natürlich versuchen, diese möglichst klein zu halten. Wie jedes Medikament hat auch jede Maßnahme Nebenwirkungen, die man nicht gänzlich abstellen kann.