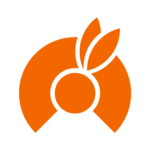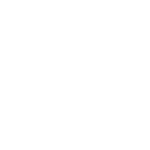Unter dem Motto „zurückSCHAUEN“ beschäftigt sich in Berlin-Johannesthal eine Ausstellung mit der Erinnerung an den Kolonialismus. Besucherinnen und Besucher sollen zu einem sensibleren Umgang mit der Kolonialgeschichte animiert werden. Das soll Rassismus entgegenwirken. Ein Bericht von Katharina Petry.

Sie werden angestarrt wie Tiere im Zoo. 106 Frauen, Männer und Kinder aus den ehemaligen deutschen Kolonien dienen im Sommer 1896 als Schauobjekte im Treptower Park in Berlin. In der ersten gesamtdeutschen Kolonialausstellung verkörpern die Schwarzen Menschen für die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Mix aus inszenierter Exotik und Fremdheit.
Heute schauen diese 106 Menschen auf die Besucherinnen und Besucher einer anderen Ausstellung zurück – und zwar aus Fotoporträts, die an den Wänden im Museum Treptow in Berlin-Johannesthal hängen. Dort befindet sich seit Oktober 2017 die Dauerausstellung „zurückGESCHAUT“. Organisiert wird sie vom Museum Treptow-Köppenick in Kooperation mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und dem Verein Berlin Postkolonial.
Ausgehend von den so genannten Menschenschauen im 19. Jahrhundert thematisiert die Ausstellung die deutsche Kolonialgeschichte, aber auch den Widerstand gegen Kolonialismus und rassistisches Verhalten. Neben Informationstafeln und einem Expertenfilm widmet sich ein Raum den 106 „ausgestellten“ Menschen. Über jeden Einzelnen von ihnen verraten Teilbiografien unterschiedliche Details aus dem Leben. Von der Arzttochter aus Namibia bis hin zum Bauern aus Tansania hatte jeder eine eigene Geschichte.
Bei der Kolonialausstellung im Treptower Park ging es nicht um die Einzigartigkeit der Menschen, die für den Sommer 1896 aus afrikanischen und ozeanischen Kolonien nach Deutschland geholt wurden. Allein ihr Aussehen und ihre Herkunft zählten, dienten diese doch der Unterhaltung der weißen Deutschen. Entgegen dem Plan der Initiatorinnen und Initiatoren wehrten sich einige der 106 Menschen gegen ihre Rolle als Schauobjekte: Sie blieben in Deutschland und beobachteten aktiv, wie sich die Macht auf die Hautfarben verteilte. Später begründeten sie die Schwarze Community in Berlin.
Moderne Menschenschauen
Auch heute noch gibt es Formate, die an die Kolonialausstellung im Treptower Park erinnern – so zum Beispiel die 2007 veranstaltete „exotische Nacht“ im Nürnberger Zoo. Unmittelbar neben Elefanten, Krokodilen und Co. vermarkteten die Initiatorinnen und Initiatioren Schwarze Menschen, indem sie sie als einheitliche „schwarze Körper“ darstellten und ihre menschliche Individualität ignorierten. Verkaufsstände boten typisch afrikanische Souvenirs an. Die afrikanische Kultur wurde damit auf die Erwartungshaltung weißer Zuschauerinnen und Zuschauer reduziert.
Auch die Show „Afrika Afrika“, die jährlich durch Deutschland tourt, greift Klischees auf und inszeniert eine einheitlich afrikanische Kultur, die sich auf Tanz, Trommeln und Theater beschränkt. Für die Leiterinnen und Leiter der Show ist das ein Sinnbild „afrikanischen Talents und Temperaments“. Sie versprechen ein magisches Zirkusspektakel.
Diversität in der Vorbereitung der Ausstellung
„ZurückGESCHAUT“ versucht rassistische Strukturen und stereotype Darstellungen von Schwarzen Menschen von Grund auf zu vermeiden. Die Ausstellung hat ein Team auf die Beine gestellt, dessen Mitglieder Schwarz und weiß sind. Die Expertise der Schwarzen Kuratorinnen und Kuratoren half dabei, das Thema Kolonialismus sensibler aufzuarbeiten, denn viele von ihnen hatten bereits persönliche Erfahrungen mit Rassismus gesammelt.
Die Aufarbeitung des Themas Kolonialismus in einem diversen Team ist einzigartig in Deutschland. Vor allem beim jungen Publikum trifft dieses Konzept auf Anerkennung. Für Matthias Wiedebusch, der dem Kuratorenteam angehört, trifft „zurückGESCHAUT“ „den Zahn der Zeit“.
Auch Tahir Della von der „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland“, ebenfalls ein Mitinitiator der Ausstellung, beobachtet einen steigenden Erfolg von „zurückGESCHAUT“ gerade bei jungen Menschen: „Das Interesse wächst tatsächlich. Die Kids stellen fest, dass die Themen Kolonialismus und Rassismus im Unterricht oder an der Uni überhaupt nicht behandelt werden. Sie merken aber, dass diese Themen wichtig sind“.
In Dellas eigener Kindheit hat die Kolonialgeschichte oder der Völkermord in Namibia keine Rolle gespielt. Durch die Aktivitäten diverser NGOs tritt es aber heute vermehrt in die Öffentlichkeit.
Straßennamen aus der Kolonialzeit
So bietet Berlin Postkolonial beispielsweise geführte Stadttouren an, bei denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die kolonialen Spuren in der Hauptstadt entdecken können. Auch der oft in Vergessenheit geratene Widerstand der Schwarzen Community kommt während der Spaziergänge durch Berlin zur Sprache. Hingewiesen wird beispielsweise auf Straßennamen aus der (Vor-)Kolonialzeit. Dazu zählt die Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die ihren Namen 1706 bekam. Damals war „Mohr“ ein Ausdruck für Schwarze Menschen, die als Sklaven gehalten wurden. Menschen wie Christian Kopp, die sich heute für die Dekolonialisierung Berlins einsetzen, sprechen deshalb lieber von der M-Straße.
Berlin Postkolonial engagiert sich für eine Umbenennung der Mohrenstraße. Kopp, der selbst in dem Verein aktiv ist, betont, dass es ihm dabei nicht darum geht, koloniale Spuren in Berlin vollständig verschwinden zu lassen. Vielmehr soll die Umbenennung der Straße zu einem kritischen Umgang mit der Kolonialgeschichte anregen. So wird derzeit auch darüber diskutiert, ob die „Petersallee“ und der „Nachtigallplatz“ im afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding neue Namen bekommen sollen. Die jetzigen Bezeichnungen sind an deutsche Kolonialherren angelehnt. Zukünftig könnten sie Namen von Widerstandskämpfern aus der Kolonialzeit tragen.
Rassistische Strukturen durchbrechen
„Die Strukturen in politischen, kulturellen und akademischen Institutionen müssen dekolonisiert werden“, sagt Kopp. Schwarze Menschen und People of Colour sollen im öffentlichen Leben angemessen repräsentiert werden. Dies gilt besonders für Projekte, die sie selbst betreffen. „Für mich als Weißer heißt das, dass ich im Zweifelsfall eine Kuratorenstelle in einem Team mit einer Mehrheit an Weißen ablehne, damit ein Schwarzer diese Stelle antreten kann“, so Kopp. Er selbst ist bei Berlin Postkolonial als Weißer eine Ausnahme. Bei Stadttouren oder anderen Großprojekten ist immer mindestens einer seiner Schwarzen Kollegen dabei.
Koloniale Strukturen aufzubrechen, kann für die weiße Mehrheitsbevölkerung unbequem sein. Es bedeutet, auch einmal auf Privilegien zu verzichten – daran sind Weiße im historisch kolonialen Kontext nicht gewöhnt. Das Gefühl, aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert zu werden, kann kein weißer Deutscher nachempfinden „Selbstansichten wie ‚kulturell weiterentwickelt‘ oder ‚zivilisierter‘ haben wir über Jahrhunderte verinnerlicht. Man muss anfangen, das abzubauen“, sagt Kopp. Vielleicht ist die Ausstellung „ZurückGESCHAUT“ ja der erste Schritt auf diesem Weg.