Dem Osten hängt das Stigma nach, “rechts” zu sein. Andere Perspektiven werden gerne übersehen. Dabei haben gerade junge Demokrat*innen viele Hoffnungen für ihr Land.

Erfurt, Samstag kurz vor neun Uhr früh. Die Stadt reibt sich den Schlaf aus den Augen, an der Kreuzung rattert die Tram. Alte Häuschen drängen sich eng aneinander. Im Café umschwirren die letzten verbliebenen Wespen die Tische, drinnen mahlt die Siebträgermaschine. Am Nebentisch mummelt eine Mutter sich und ihr Kind in eine Wolldecke ein, trotz der Morgenfrische lässt sich schon jetzt erahnen, dass wieder ein warmer Tag wird.
Die Stadt erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf, wie jede andere. Der Frieden liegt wie ein Deckmantel über der Stadt, strahlt eine „Alles ist gut“- Atmosphäre über mich und meinen Cappuccino mit Hafermilch aus und lässt nichts von den Demonstrationen am Nachmittag erahnen, bei denen laut Polizeiangaben um die Tausend für und etwa 4000 gegen die AfD auf die Straßen ziehen werden.
Wie entsteht dieses Narrativ, der Osten sei „rechts“?
„Ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, dass Menschen nicht einfach leere Gefäße sind, in die man einfach irgendwas reintun kann.“ Das sagt Katja Maurer, Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen. Ich treffe sie im Büro der Linksjugend: Das Fenster mit Wahlplakaten zugekleistert, es ist chaotisch und heimelig zu gleich, auf der Heizung steht ein leeres Glas Bio-Aufstrich. Mir ihr und Vertreter*innen von anderen Jugendparteien habe ich über ihre Ängste und Hoffnungen für Thüringen gesprochen. Darüber, was sie antreibt und ob es ihrer Meinung nach immer noch die sprachliche Teilung zwischen Ost- und Westdeutschland braucht. Maurer erklärt, Menschen würden sich selbst eine Meinung bilden. Unabhängig, davon, wie sie selbst dazu stehe, müsse sie das zur Kenntnis nehmen. „Es gibt eben die Einen, die zum Beispiel der Meinung sind, dass Migrant*innen schlecht für unser Land sind“, sagt die Politikerin. Gleichzeitig gebe es andere Menschen, die Migration positiv sähen. Menschen hätten einfach unterschiedlichen Wertevorstellungen.
„Ich finde, es wäre doch schon etwas Schönes, wenn man sich gegenseitig zuhört,“ meint der Stadtrat Luc Rechenbach von der Jungen Union (JU). Auf Worte auch Taten folgen zu lassen, dass beschäftigt gerade die Jungen Liberalen (JuLis): „Wir haben bei den JuLis sehr viele Mitglieder, die parallel noch andere Ehrenämter haben. In irgendwelchen Kirmes-Vereinen sind oder Gardetanz. Oder halt auch zum Beispiel hier Einen im Erfurter Bereich so einer Foodsharing-Aktion an Uni mitmacht. Aber die erzählen halt nicht darüber,“ sagt Patrice Klohn, Pressesprecher*in der Jungen Liberalen in Thüringen.
Auch bei Freund*innen aus anderen Jugendorganisationen sei es ähnlich. Andere Themen würden den Alltag bestimmen. „Man merkt schon, dass Leute keinen Bock auf gerade stattfindende Politik haben und Menschen, die sich politisch engagieren, etwas schief anschauen.“ berichtet hingegen Janek Schmidt von der Grünen Jugend Thüringen. Aber ein politisches Klima lasse sich nicht allein durch Politik beeinflussen. „Was mir gerade in Thüringen Hoffnung macht, ist, dass gerade in fast allen Regionen Anti-Rechts-Bündnisse entstehen, die versuchen, den Raum zu gestalten, der die letzten Jahre einfach komplett vergessen wurde,“ meint Schmidt. Hoffnung, das haben alle Jugendorganisationen gemeinsam, zögen sie aus Gemeinschaft.
„Ich mache jetzt seit acht Jahren Queerpolitik,“ meint Patrice Klohn von den JuLis. Damals habe es in Thüringen drei Christopher Street Days (CSDs) gegeben, in Erfurt, Jena und Weimar. Seitdem habe sich viel verändert. „Heute schaffe ich es nicht mehr, auf jeden CSD zu gehen“, erzählt Klohn.
Erfurt, Samstagnachmittag. An der Gera plantschen Kinder mit den Füßen im Wasser und trotzen der Hitze.
Keinen Kilometer entfernt haben sich 4000 Demonstrant*innen vor dem Domplatz versammelt, um gegen die AfD-Kundgebung zum Wahlkampfabschluss zu protestieren. Laute Rufe und bunte Plakate überfluten die Stadt. Die Grenzen zwischen den Demonstrant*innen und der Kundgebung sind mit einer Autoblockade der Polizei klar abgesteckt. Es ist so laut, dass vom Domplatz nur nach draußen dringt, wer gerade am Mikrofon steht. Die Sonne knallt auf den Asphalt, wie die Wertevorstellungen aufeinander. Meine Uhr sagt mir, ich solle gegen meinen Stress anatmen. Demonstranten Platz machend, trete ich an die Hauswand zurück. Neben mir ein Vater mit Kind auf dem Arm, keine drei Jahre alt und Eiscreme schleckend. Zu klein, um sich später daran erinnern zu können, bleibt doch ein Gefühl von zuckersüßer Gemeinschaft zurück.
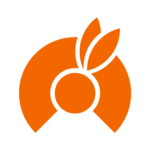
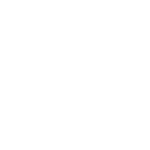
1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Liebe Charlotte,Du hast wirklich ein großartiges Talent zu schreiben.Da ist ist vielleicht ein Berufsweg vorgezeichnet!! Toll,wie gut und interessiert Du in die Menschhh eh n und die Dinge schaust!!