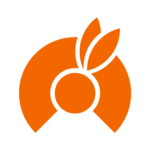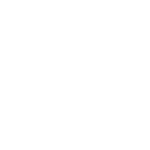Der Generation von morgen muss auch heute schon etwas geboten werden. Würde man dabei nur auf einen Sportverein oder auf eine Musikschule setzen, würde man immer nur einen Teil aller Jugendlichen erreichen. Aber mit Mitspracherecht auf kommunaler Ebene hätten alle die Möglichkeit, den Ort, an dem sie sich am meisten aufhalten, nach ihren Wünschen zu gestalten. 16 „Referenzkommunen“ versprechen, Jugendgerechtigkeit zu steigern. Ob das funktioniert?
Schaut man sich einmal die Dörfer und Städte in Deutschland genauer an, merkt man schnell, dass manche mehr und manche weniger Aktivitäten für Jugendliche bieten. Gerade auf dem Land stößt man oft auf Regionen, in denen kaum etwas für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen getan wird. So gibt es zum Beispiel Dörfer, aus denen man ab 17 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr rauskommt, von denen die nächste Disco aber eine Stunde entfernt ist. Gäbe es mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung innerhalb dieser Dörfer, wäre das Busproblem nur noch halb so schlimm. „Wir haben einen Skatepark bekommen, aber den dürfen die Jugendlichen noch nicht einmal so herrichten wie sie wollen. Wenn sie sich die Kanten zum Skaten verbessern, meckern die Erwachsenen noch“, beschwert sich der Jugendpfleger Jannis Gerling, ein Teilnehmer der Jugendkonferenz in Berlin.
Neue Wege − Referenzkommunen
Aber es geht auch anders: Das Projekt „Referenzkommunen“ soll den Jugendlichen direkt in ihrer Heimat, etwas bieten. Schon im Mai 2014 erkannte die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ die Notwendigkeit, sich näher mit Kommunen zu beschäftigen. Deshalb begannen sie noch im Herbst desselben Jahres, eine Lösung zu entwickeln. Das Ergebnis: Ein Aufruf an alle Kommunen in Deutschland. 60 Kommunen wollten mithilfe des Projekts innerhalb von drei Jahren (2015-2018) jugendgerechter werden. 16 erhielten eine Zusage, aus jedem Bundesland eine − die sogenannten „Referenzkommunen“.
Die Teilnahme am Projekt ist allerdings keine Auszeichnung, sondern ein Versprechen. Ein Bürgermeister verspricht der Öffentlichkeit, seine Kommune innerhalb von drei Jahren jugendgerechter zu machen. Es gibt keinen Zwang, etwas zu verändern, aber durch das Versprechen ist es natürlich von Vorteil, es zu tun. Das Versprechen gibt Land und Öffentlichkeit die Möglichkeit, Druck auf die Kommunen auszuüben. Um sie dabei zu unterstützen, besucht die Koordinierungsstelle die Kommunen direkt und gibt ihnen Denkanstöße – aber keine Empfehlungen, etwas Konkretes zu tun. Ziel ist es stattdessen, mit den Jugendlichen gemeinsam konkrete Lösungen zu finden. Für Entscheidungsmacht seitens der Jugendlichen sorgen zum Beispiel 1.800€ Förderung, die die Jugendlichen selbst verwalten dürfen. Sie können das Geld in die Hand nehmen und für etwas ausgeben, was ihnen in ihrer Heimatstadt fehlt.
Wenn der Bürgermeister mauert
In der Theorie hört sich das Projekt „Referenzkommunen“ perfekt an − aber wie so oft gibt es bei der Umsetzung noch Verbesserungsbedarf. Die Teilnehmenden auf der Jugendkonferenz nennen auch einige Kritikpunkte: Fehlende Kommunikation zwischen Kommunalverwaltung und Jugendlichen, Unbekanntheit des Prozesses, die eine Folge aus mangelnder Öffentlichkeitsarbeit und wenig konkreten Konzepten ist. Außerdem haben nur 16 von 60 Bewerbern die Möglichkeit, das Projekt bei sich umzusetzen, sodass die Referenzkommunen nur einen Bruchteil der Situation in Deutschland repräsentieren.
Im Bundesland Schleswig-Holstein hat die Kleinstadt Bad Segeberg es zur Referenzkommune geschafft. Mit der Jugendbeteiligung sieht es allerdings trotzdem ziemlich rar aus. Hellena Wagemann ist Vorsitzende vom Kinder- und Jugendbeirat in Bad Segeberg, der auch schon einiges erreicht hat: Vor kurzem konnten sie die Schließung eines Jugendzentrums verhindern und haben einen regelmäßigen „Poetry Slam“ auf die Beine gestellt. Hellena persönlich freute sich vor allem über eine Informationsveranstaltung, bei der Jugendliche und Verwaltung endlich einmal auf Augenhöhe getagt hätten.
Hellena hat allerdings vor allem Kritik mit nach Berlin gebracht. „Wir haben in Bad Segeberg eine Zukunftswerkstatt veranstaltet, aber der Bürgermeister hat unsere Vorschläge und Ideen sofort abgelehnt“, erinnert sie sich. Die anfängliche Euphorie der Jugendlichen verflog daher schnell und Frustration zog ein. Für Hellena lag die Ironie vor allem darin, dass eine Woche nach der Zukunftswerkstatt eine neue Kindergartengruppe in das Jugendzentrum von Bad Segeberg zog. Das große Jugendzentrum, das eigentlich ein Platz für die Jugendlichen sein sollte, wird jetzt nach und nach zu einem Kindergarten umgestaltet, weil der Platzprobleme hat. Schon seit Langem kämpfen die Jugendlichen auch für einen Skatepark, weil der letzte in einer Licht- und Nebelaktion abgerissen worden sei. „Es wird viel gesagt, aber nichts getan“, schließt Hellena. In Bad Segeberg hat das „Referenzkommunen“-Projekt bisher nicht viel bewirkt.

Jugendliche in der Flüchtlingshilfe
Aber es gibt auch andere Fälle – zum Beispiel Trier. Nach einer langen Eingewöhnungsphase bilden sich nun langsam Strukturen, in denen Jugendliche arbeiten können. „Obwohl es Kommunikationsschwierigkeiten mit dem frischgewählten Bürgermeister gibt, hat das Jugendparlament in Trier schon einiges auf die Beine gestellt: Die Erhaltung einer Grundschule, einen Trommelworkshop, die Sanierung des Jugendzentrums und verschiedene Projekte im Bereich Flüchtlingshilfe wie zum Beispiel Kochworkshops“, berichtet Alexander Feltes, Mitglied des Jugendparlaments und Vertreter im Schulträgerausschuss. Er hat allerdings auch ein persönliches Anliegen, das auf Landesebene geklärt werden müsste: Die Erstattung von Fahrkartenkosten in der gymnasialen Oberstufe.
Referenzkommunen sind also ein guter Ansatz − nur bei der Umsetzung gibt es noch Probleme. Vor allem dann, wenn vor Ort der politische Wille fehlt. Noch haben die Kommunen aber zwei Jahre Zeit, um ihr Versprechen einzulösen. Es bleibt also abzuwarten, ob das Projekt 2018 als gelungen oder gescheitert abgestempelt wird.