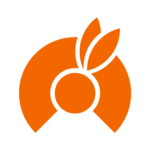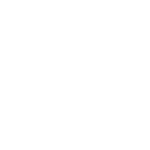Die Bundestagsabgeordnete und Grünen-Politikerin Renate Künast engagiert sich lautstark gegen Hate Speech. Inga Glökler, Katharina Petry und Felix Seyfert haben mit ihr über Hass, den Umgangston im Bundestag und ihre eigene Identität gesprochen.

Frau Künast, leben wir in einer hasserfüllten Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft ist durch ihre Wahrnehmung der Social Media geprägt. Dort findet viel Rassismus, Antisemitismus und Hass statt. Ich glaube aber nicht, dass das in der Realität mehr geworden ist. Bestimmte Einstellungen sind immer in unserer Gesellschaft vorhanden. Um das herauszufinden, darf man natürlich nicht fragen: „Sind Sie rechtsextrem?“. Es geht um die konkreten Inhalte. Zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung sind feindlich gegenüber anderen eingestellt, egal, aus welchen Kreisen sie selbst kommen. Meiner Erfahrung nach hat sich Hass in der Vergangenheit nur unterschiedlich gezeigt. Die NPD hing immer stark dem Nationalsozialismus an. Die AfD dagegen war ja ursprünglich eine eurokritische Partei, die von Bernd Lucke gegründet wurde. Ihr schlossen sich Menschen an, die andere Einstellungen hatten und Lucke schließlich „herausdrückten“. Und jetzt sieht man durch Höcke, Gauland, Storch und Co. wie die Partei immer weiter nach rechts geschoben wird. In der AfD hat die Neue Rechte einen neuen Organisationsrahmen gefunden, unter den auch Pegida fällt. Meine These ist, dass sich der Hass nicht vermehrt, sondern nur umorganisiert hat und moderne Werkzeuge nutzt.
Wie zeigen sich Hass und Rassismus – abgesehen von der AfD – im Bundestag?
Rassismus ist eine Verkürzung, im gleichen Atemzug müssen wir auch über Sexismus und Antisemitismus reden. Die AfD macht durch ihre Sprache klar, was ihre Ansichten sind. Extreme Einstellungen äußern sich aber auch oft auf eine Art, bei der man genauer hinschauen muss. Bei der #metoo-Debatte wurde immer wieder von vielen Seiten gesagt: „Das ist doch nur Spaß“. Man war der Spielverderber, wenn man sich wehrte.
Auch beim Thema „Grenzen schließen“ merkt man, dass auf einer bestimmten Klaviatur gespielt wird. Man muss sich zum Beispiel nur einmal anschauen, was der neue Bundesinnenminister dazu sagt. Die Frage ist: Warum gibt es keinen Wirkmechanismus in den Leuten, keinen Anstand, der ihnen sagt, dass man keine Hassparolen verbreiten sollte?
Ich glaube, es kommt daher, dass man behauptet, man sei bürgerlich, und habe einen gewissen Anstand. Nach und nach wird das dann demaskiert. Menschen, die Hass verbreiten wollen, bedienen sich extremer Emotionen, um Gefühle gegen eine Partei, Politikerinnen und Politiker oder auch andere Menschengruppen zu organisieren. Der Gesundheitsminister Jens Spahn sprach neulich abschätzig von „Wirtschaftsflüchtlingen“. Er benutzt das Wort als absolute Abwertung, um das Gefühl zu bedienen, dass Ausländer uns die Arbeitsplätze stehlen.
Der Alltag wird dadurch verändert, es kommt zu einer Art „Temperaturerhitzung“. Das ist eine ganz neue, latente Form von Rassismus. Diese führt zu mehr Aggressionen oder auch Übergriffen wie in Niederdorf. Die verbale Verschiebung tendiert nach rechts. Die Frage ist: Bedienen wir Emotionen oder klären wir sachlich auf?
Auch online schlägt die Sprache um: Rassismus wird durch Hasskommentare sichtbar. Was kann man gegen diese virtuelle Gewalt tun?
Zuallererst gilt es, darüber zu reden und das Ganze öffentlich zu machen. Man darf diese Kommentare nicht auf sich selbst beziehen. Frauen werden oft „hässlich“ genannt, wie neulich Frau Kramp-Karrenbauer. Natürlich ist sie nicht „hässlich“. Aber was ist das für ein Mensch, der so etwas schreibt, retweetet und dem generell nichts Besseres einfällt, als über das Aussehen der neuen Generalsekretärin der CDU zu schreiben?
Man muss sich vor Augen führen, dass solche Menschen demokratische Prozesse zerstören möchten. Sie wiederholen Dinge immer wieder, tun so, als seien alle Politiker Deppen.
Unser Begriff von Meinungsfreiheit ist sehr breit angelegt, und das ist gut so. Es führt allerdings auch dazu, dass manche Menschen anfangen, ihn umzuformulieren. Neulich in Niederdorf wurden Angela Merkel und Sigmar Gabriel als Volksverräter bezeichnet und symbolisch an einen mit ihren Namen versehenen Galgen gehängt. Das lehnt klar an die NS-Zeit an. Es gibt einen Punkt, an dem es Zeit ist, Dinge anzuzeigen und sich gemeinsam zu wehren. Gegenwehr gibt es übrigens auch online. Im Netz gibt es viele Initiativen und Bewegungen, wie die Hashtag-Kampagne #wirsindhier, die einem dabei helfen, dem Hass zu trotzen.
Ein schönes Beispiel sind die Datteltäter. Das sind Youtuberinnen und Youtuber, die Videos gegen Fremdenhass machen und aufklären. Die sind cool. Und sie zeigen schon Schulkindern, was geht, und was nicht.
Im Gegensatz zu den Opfern sitzen die Täterinnen und Täter von Hasskommentaren oft desozialisiert vor ihrem Computer. Wie erreicht man diese Leute präventiv?
Ein schwieriger Punkt. Es gibt Menschen, die kommen aus der digitalen Welt gar nicht mehr heraus. Aber auch Personen, die in einer Blase leben, kommunizieren. Ich glaube, man muss präventive und rechtliche Hilfe miteinander verbinden. Um präventiv zu arbeiten, bedarf es Medienkompetenz an Schulen und in allen anderen Lebensbereichen, etwa beim Sport. Es geht ums Kommunizieren und um den Anstand. Die digitale und die analoge Welt haben sich miteinander verbunden. Kommentare, Likes und Posts im Netz sind für Opfer realer Druck. Man muss sich kritisch darüber unterhalten, was da genau passiert.
Sie setzen sich für einen guten Ton in unserer Gesellschaft ein, sind Mitglied im Nationalkomitee der No Hate Speech Movement und haben im August 2017 ihr Buch „Hass ist keine Meinung“ veröffentlicht. Was bewegt Sie persönlich zu Ihrem Engagement gegen Hass?
Dazu gekommen bin ich über meine eigenen Erfahrungen. Ich wurde teilweise mit Hasskommentaren überschüttet. Nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln sagte ich bei der Talkshow „Hart aber Fair“ meine Meinung: Ich sagte, dass sexuelle Gewalt auch im Alltag häufig vorkommt, und wir auch darauf schauen müssen. Die Art der Debatte um die Silvesternacht war wie ein kurzer Hype, wohl auch weil es um Nordafrikanerinnen und Nordafrikaner ging. Die #metoo-Debatte zeigt aber, dass das Feld noch weiter ist. Am nächsten Tag las ich auf Facebook Kommentare wie „einige Afrikaner müssten mal über Sie steigen“. Das waren Kommentare, aus denen nur eines sprach: Hass, Hass, Hass.
Ich frage mich: Was passiert da eigentlich in unserem Land? Und ab da konnte ich nicht einfach stehen bleiben. Der erste Schritt war für mich, laut zu sein – zu sagen, dass der Hass existiert. Es gibt viele andere Leute, die so etwas erleben, und für die möchte ich meine Stimme erheben. Schweigen kommt für mich nicht in Frage, und immerhin führen wir durch mein direktes Ansprechen von Hass nun eine gesellschaftliche Debatte über das Thema. Daran knüpft auch mein Buch „Hass ist keine Meinung“ an.
Für Ihr Buch haben Sie die Täterinnen und Täter der Hasskommentare aufgesucht und sie zur Rede gestellt. Was waren die Reaktionen auf diese Methode?
Die Reaktionen waren sehr positiv. Viele Leute fragen sich ja selbst, wie man reagieren sollte. Gibt es überhaupt eine klare Antwort auf Hass?
Meine Herangehensweise – zu hinterfragen, wo der Hass herkommt, indem ich die Leute, die mich öffentlich angreifen, besuche – kam gut an.
Auch ich habe dadurch Hinweise bekommen, was die Leute umtreibt. Mittagessen in Schulen, miserable Bezahlung von Erzieherinnen, Erziehern, Pflegerinnen und Pflegern, Arbeitslosigkeit, Altersarmut – über diese Themen müssen wir im Bundestag tatsächlich mehr diskutieren. Einen Mann, den ich besucht habe, fragte mich: „Kümmert sich auch mal wieder jemand um uns?“
Neben dem Buch habe ich übrigens auch ein ironisches Facebook-Tool öffentlich gemacht. Darin beschreibe ich, wie mir Menschen am besten Hate-Posts zuschicken können. Ich wollte mich darüber lustig machen. Das war meine Methode, mit dem Hass umzugehen.
Was bedeutet Identität für Sie?
Eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Die Antwort „ich bin deutsch“ reicht nicht aus. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, einem Schmelztiegel, und unmittelbar an der Grenze zu Holland. Es war ein Teil meiner Kindheit, die offenen europäischen Grenzen zu erfahren, und ohne Personalausweis zwischen den Staaten hin und herzufahren. Diese Offenheit macht mich nun aus. Für mich sind meine Werte, Ziele, und vor allem meine Verantwortung meine Identität. Mich einzumischen und alle Menschen respektvoll zu behandeln, das macht mich aus.