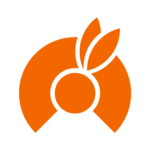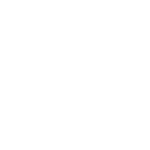Einen Großteil der YouthCon 2016 verbringen die Teilnehmenden in Workshops. Doch was genau passiert dort eigentlich? Helene Fuchs hat sich undercover in einen Workshop gesetzt und direkt miterlebt, wie die Teilnehmenden die Methode des Design Thinking kennengelernt haben.

Der Morgen nach der Abschlussparty. Verschlafene Gesichter, halbverdeckt von Kaffeetassen. Langsam und verspätet begeben sich alle nach und nach zu den einzelnen Workshops. Im Seminarraum S1 hat man hohe Ziele: Design Thinking soll erklärt werden. Es handelt sich um eine Möglichkeit, menschenzentrierte Lösungen für Probleme zu entwickeln. Wie genau? Das scheint keiner so recht zu wissen. Trotz Müdigkeit wirken alle gespannt. „Ich glaube, es wird kreativ“, ist offenbar der einzige Anhaltspunkt. Auch das Internet, das ich vorher fleißig konsultiert habe, gibt nicht mehr her. Ich erfahre nur: Diese Idee liegt momentan total im Trend und existiert in unzähligen Varianten und Anwendungsbereichen.
Perfektion? Nein!
„Es ist nicht alles so schwierig, wie es sich erstmal anhört“, lautet die Prämisse unseres Workshop-Leiters Marian Turowski. Der 27-jährige hat die Methode in Potsdam studiert, neben seinem Hauptfach Wirtschaftsingenieurwesen. Gut gelaunt beginnt er uns zu erklären, wie man „wie ein Designer denkt“. Genau bedeutet das, Menschen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt von Ideen zu stellen. Für komplexe Fragestellungen, die dynamisch und nicht linear sind, fällt es uns deutlich schwerer, Lösungen zu finden. Die Methode soll dem entgegenwirken und Werte, Technologie und Wirtschaftlichkeit vereinen. Das Ganze sei vollkommen ergebnissoffen und definitiv nichts für Perfektionisten und Perfektionistinnen. Soweit die Erklärungen von Marian.
Auf diese kurze Einführung in die Methode, die uns immer noch über die genauen Inhalte im Dunklen lässt, folgt der praktische Teil. Unsere Aufgabe: Das ideale Portemonnaie kreieren. Zunächst sollen wir einen Entwurf zeichnen, was die Mehrheit der Teilnehmenden genervt aufstöhnen lässt. „Ich kann aber nicht malen!“, höre ich von allen Seiten. Und auch ich bezweifle, dass irgendjemand später erkennen kann, was genau auf meinem Blatt abgebildet ist. Marians Antwort: „Stichwort: Perfektheit, Antwort: Nein!“
Radikal und verrückt denken
Wir kritzeln also meist mehr schlecht als recht auf unsere Blätter und machen uns Gedanken, was eigentlich alles in unserem Geldbeutel verstaut werden muss. Nach zwei Minuten kommt es jedoch zu einem Perspektivwechsel: Wir beginnen, uns mit unserem Gegenüber auszusuchen und versuchen herauszufinden, was dem anderen wichtig ist. Die Anweisung, nach Emotionen beim Gespräch über Portemonnaies zu suchen, bringt den Saal zunächst zum Lachen. Aber als ich die Vermutung äußere, dass mein Partner viel Wert auf Sicherheit legt und er mir dann erklärt, er sei Polizist, verstehe ich diese Zusammenhänge besser.
Ein paar Minuten fröhlichen Austauschs später sollen wir schließlich eigene Ideen zur Lösung entwickeln. Es heißt also: Weiterzeichnen! Quantität statt Qualität lautet das Motto. „Denkt radikal und verrückt!“, fordert uns Marian auf. Die Entwürfe sollen dann mit Hilfe von Kreppband, Alufolie, Moderationskarten und Pfeifenreinigern gebastelt werden. Abstrakte Ideen anfassbar machen ist ein zentraler Punkt des Design Thinking. Ich klebe also acht Minuten lang Post-its zusammen und versuche, mich nicht von der mangelnden Ästhetik meines Werks entmutigen zu lassen. Meinem Streben nach Perfektion wird ein starker Dämpfer versetzt, was mir allerdings weniger ausmacht als zu Beginn befürchtet. Und auch die strikte Zeitbegrenzung beflügelt mich eher, als dass dadurch meine Kreativität gehemmt wird.
Als wir unseren Partnern die Ergebnisse vorstellen, zeigt sich: Die Perspektive zu verändern ist gar nicht so schwer. Und führt sogar bei den meisten zu praktikableren Ergebnissen als der eigene Entwurf vom Anfang. Ich bin überrascht von der guten Idee meines Gegenübers, Karten oder Kassenzettel leporelloartig anzuordnen und immer mehr davon überzeugt, dass das Konzept gut funktioniert.
Keine Angst vor Misserfolgen
Die Verbesserungsvorschläge der anderen können wir aufgrund der fehlenden Zeit genauso wenig umsetzen, wie eines der wichtigsten Prinzipien der Methode – in diversen Teams zu arbeiten. Was aber der Workshop eindrucksvoll vermittelt, ist das Vertrauen in die eigene Kreativität und Intuition. Laut Marian liegt dort der Schlüssel zu Innovation. Beobachten, nachfragen, erleben und die Perspektive wechseln müssen nicht kompliziert sein. Es reichen ein wenig Vorbereitung, Moderationskarten oder Post-its und der Mut zum Scheitern, um neue Ansätze zu finden.
Es sei völlig legitim, im Falle eines Misserfolgs nochmal neu anzufangen oder einzelne Schritte zu wiederholen, erklärt uns Marian. „Fail early and often“ ist auch die Lektion, die mir am meisten im Gedächtnis bleibt. Und so werde ich wohl in Zukunft bei meiner Projektplanung in Kürze jeder Idee nachgehen und zur Not auch mal was basteln.