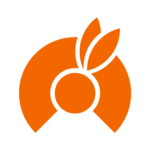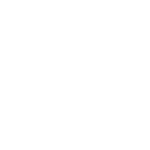Rebecca Maskos ist freie Journalistin und Autorin. Aufgrund der Glasknochenkrankheit sitzt sie im Rollstuhl. Im Interview mit Tatjana Tiefenthal und Lilith Grull berichtet sie über ihren Arbeitsalltag.

Wie vielfältig ist der Journalismus heutzutage?
Aus meiner Sicht nicht sehr vielfältig. Ich habe den Eindruck, dass in erster Linie Menschen zum Journalismus kommen, die gute Startchancen im Leben haben: Zum einen braucht man immer Abitur, zum anderen Eltern, die einen finanziell unterstützen können. Ich konnte sehr viele Praktika machen, weil ich nicht nebenbei jobben musste. Die mediale Welt spiegelt heute primär die weiße Mittelschicht wieder. Andere Perspektiven tauchen eher selten auf.
Bei Leuten mit Behinderung ist zudem oftmals der Bildungsweg durch Sonderschulen und ähnliches schwieriger. Viele schaffen es gar nicht erst auf eine Universität und das nicht aufgrund ihrer schulischen Leistung. Alleine das macht es für Menschen mit Behinderung sehr viel schwieriger in den Journalismus reinzukommen.
Hattest du schon einmal Hürden in deinem journalistischem Alltag?
Es ist schon so, dass ich oft nicht als Journalistin wahrgenommen werde. Im Zuge eines Praktikums habe ich mal über die Eröffnung eines Altenheimes berichtet und mich mit dem Leiter unterhalten. Am nächsten Tag war ein Foto von mir in der Zeitung mit dem Titel: Leiter des Altenheimes spricht mit einer Bewohnerin. Das man auch im Rolli Journalistin sein kann, kommt in den Köpfen vieler Leute gar nicht vor. Es gibt aber nicht nur Nachteile. Politiker, die mit einer grimmigen Mine aus einer Konferenz kommen, und mich sehen, ändern sofort ihr Verhalten, fangen an zu lächeln und gehen in die Hocke. Auf der Leitungsebene gab es auch immer wieder Zweifel, ob ich die Arbeit auch schaffe. Es gab viele Vorbehalte, dass ich nicht flexibel einsetzbar sei. Mein Fazit: Man benötigt wohl ein sehr selbstbewusstes Auftreten und eine ganz klare Haltung als Mensch mit Behinderung im Journalismus.
Wie bist du zum Journalismus gekommen?
Ich hatte schon immer Spaß am Schreiben. So bildete sich schon früh die Idee, im publizistischen Bereich tätig zu sein. Besonders die Informationsvielfalt hat mich gereizt. Nach der Schule habe ich immer wieder Praktika gemacht, hatte aber die Befürchtung, dass es aufgrund meiner körperlichen Einschränkungen schwierig werden könnte. Um ein zweites Standbein zu haben, absolvierte ich erst einmal ein Psychologiestudium. Meine Befürchtungen haben sich nach meiner einstimmigen Annahme an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin bestätigt. Nach dem Bescheid riet mir die damalige Leitung deutlich dazu den Platz abzulehnen. Es würden doch zu viele Umstände für sie, aber doch vor allem auch für mich, entstehen. Bei meinen Praktika davor hatte ich noch nichts davon bemerken können. Glücklicherweise habe ich kurz darauf die Zusage für ein Volontariat bei Radio Bremen erhalten. Bewusst habe ich mich dafür und somit einen gerechten Umgang entschieden.
Hast du das Gefühl, dass Menschen mit Behinderung im Journalismus unterrepräsentiert sind?
Ja, auf jeden Fall! Ich glaube, es gibt eine Menge Leute mit Behinderung, die gerne schreiben. Das sieht man auch an der Vielzahl von Blogs, aber dass man tatsächlich eine Anstellung bekommt, ist eher selten. Journalismus ist ein Beruf, der viel Mobilität und Flexibilität erfordert, dies erleichtert die Gesamtsituation nicht. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist. Ich kenne mehrere Journalisten mit verschiedenen Behinderungen. Es gibt Hilfsmittel, die die Arbeit ermöglichen, oder auch eine Arbeitsassistenz, die man beantragen kann.
Du hast dich sehr bei dem Projekt Leidmedien engagiert. Hast du das Gefühl, dass sich die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung verbessert hat?
Ja, ich hab schon das Gefühl, dass es sich ein bisschen verbessert hat. Wir waren selber total überrascht, wie viel Erfolg wir mit Leidmedien hatten. Aus meiner Sicht ist die Berichterstattung etwas neutraler geworden, vielleicht weil das Thema auch endlich Gehör findet.