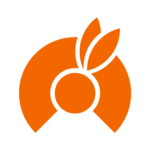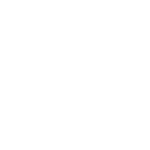Für einige ist die Schule ein Zufluchtsort – für Melina und viele andere Kinder an Brennpunktschulen war sie das Gegenteil. Als junges Mädchen floh sie nach Deutschland, heute erzählt sie von Ungerechtigkeiten, die oft unbenannt und unbekannt bleiben.

Ein schwüler Sommertag 2014. Mit nassen Haaren kommt Melanie vom Schul-Schwimmunterricht zurück, doch ihr Schulranzen, den sie im Klassenraum abgestellt hatte, ist verschwunden. Panisch läuft sie durch die Grundschule. Sonne durchflutet die Gänge, der Schulhof und sein Spielplatz alt und etwas heruntergekommen. Sie findet ihren Ranzen ausgeleert im Mülleimer auf der Schultoilette – ohne Stifte und Mappen. Der Geruch von der stinkenden und beschädigten Toilette steigt ihr in die Nase.
Melina floh mit vier Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland und besuchte fortan eine Grundschule in einem sozialen Brennpunkt. So bezeichnet man Wohnviertel, in denen besonders viele Menschen in relativ armen und sozial benachteiligten Verhältnissen leben. Diese Orte sind oft geprägt von vielen ausländischen Familien, einer hohen Bevölkerungsdichte und unzureichender Infrastruktur. Der Begriff „sozialer Brennpunkt“ steht in der Kritik, weil er nur die negativen Aspekte dieser Wohngebiete beleuchtet und die Menschen dort stigmatisiert, während die positiven Seiten, wie ein Klima der Gemeinschaft und die große kulturelle Vielfalt, verschwiegen werden.
Kriminalität und Gewalt
Kinder und Jugendliche aus Brennpunktvierteln und -schulen sind von benachteiligenden Lebens- und Bildungschancen betroffen, zum Beispiel durch ihren täglichen Kontakt mit Kriminalität und Rassismus in der Schule.
Sie erzählen im Nachhinein, dass Gangbildungen, Pausenprügeleien und Feueralarm an der Tagesordnung standen und das Lernen schwerwiegend behinderten. Eine repräsentative Umfrage der Robert Bosch Stiftung ergab, dass es laut fast jeder zweiten Lehrkraft (47 Prozent) ein Problem mit psychischer oder physischer Gewalt unter Schüler*innen gäbe, insbesondere in sozial benachteiligten Lagen (69 Prozent). Ein Drittel der Lehrer*innen berichtete, dass sie eine hohe emotionale Erschöpfung jede Woche, manche sogar jeden Tag verspüren. Die treffe vor allem auf jüngere, weibliche Lehrkräfte und Grundschullehrer*innen zu.
Melina kommt aufgelöst zu spät zum nächsten Fach und wird von ihrem Lehrer getadelt. Sie kann sich nicht verteidigen, da sie gerade erst Deutsch lernt. Zum Glück eilen Freundinnen ihr zur Hilfe.
Soziale Ausgrenzung und fehlende Schulungen
Nicht jedes Kind findet Anschluss wie Melina. Es kommt vor, dass Kinder sowohl von Lehrer*innen als auch von Mitschüler*innen diskriminiert werden, wenn sie sich zum Beispiel schulisch anstrengen und gute Leistungen erzielen möchten. Von ihrer Peergroup werden Kinder mit guten Noten teils als „Streber“ sozial ausgegrenzt, weil sie sich dem vorwiegenden Lebensstil des Quartiers nicht zugehörig fühlen, während sie von Lehrkräften oft aufgrund von mangelndem Verständnis und fehlender Schulung weniger oder ineffektiv gefördert werden.
International verglichen, besuchen deutsche Lehrer*innen deutlich weniger Fortbildungen zu pädagogischen Kompetenzen; die erweiterte Schulung liegt bei 23 Prozent im Vergleich zu 73 Prozent international. Dabei fordere das Verhalten der Schüler*innen und der heterogenen Klassen die Lehrer*innen laut eigenen Angaben am meisten heraus, denn Kinder mit Flucht- und Krisenerfahrungen oder mit Behinderungen benötigen eine entsprechende Unterstützung. Außerdem bemängeln Lehrkräfte in der Studie, dass sie kaum Rückmeldung zur eigenen Arbeit erhalten, was eine Verbesserung eines adäquaten pädagogischen Umgangs weiter erschwert.
Melina geht mit hungrigem Magen nach Hause, weil die erste Gruppe der Nachmittagsbetreuung das warme Essen aufgegessen hat. Es gibt nicht genug für alle. Auf dem Nachhauseweg, an der Bahnhaltestelle, wird sie von Jungen aus höheren Klassen belästigt. Sie rufen ihr zu. Sie äffen sie nach und kommen ihr und dem leeren Ranzen zu nah. Als ihre Eltern fragen, wie ihr Tag war, fällt es ihr schwer, davon zu erzählen. Sie bezweifelt, dass sie ihr wirklich helfen könnten.
Chancengleichheit dringend nötig
Es ist längst wissenschaftlich bewiesen, dass Chancengerechtigkeit – abgesehen vom Aspekt der (generationenübergreifende) Armut – aufgrund eines anderen sozialen und kulturellen Habitus eingeschränkt wird, das heißt aufgrund des Elternhauses und einem benachteiligten sozialen Netzwerk. Zum Beispiel können sich Eltern, die sich mit dem deutschen Bildungssystem auskennen, die deutsche Sprache gut beherrschen und sich mit der Nachbarschaft bzw. Schulgemeinschaft verstehen, viel eher für die Fördermöglichkeiten ihres Kindes einsetzen, während kürzlich migrierte Familien von solchen Informationen keinen Wind bekommen, geschweige denn im Förderrat oder mit Lehrer*innen diskutieren können.
Auf lange Sicht würde sich eine effektivere und größere Investition des Staates in Kinder, zum Beispiel durch die Ausweitung des Startchancen-Programms auf mehr Kinder „nicht nur sozial- oder bildungspolitisch, sondern auch aus ökonomischer und fiskalischer Sicht“, also gesamtgesellschaftlich auszahlen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft, im Auftrag des Deutschen Komitees für UNICEF.
Spätestens die Corona-Krise hat gezeigt, wie ungerecht die Bildungschancen sind: Ressourcen für elektrische Ausstattung, wie Tablets, stabiles Internet sowie eine friedliche Lernatmosphäre und helfende Eltern zu Hause beeinflussen die mentale Gesundheit und den Lernerfolg maßgeblich, doch sind sie keine Selbstverständlichkeit. Insbesondere nicht in Brennpunktvierteln, wo sich verschlechternde Lebenszustände zunehmend normalisiert und geduldet werden. Abzuwarten bleibt, ob bei der Bundestagswahl im Februar die Frage der Förderung und Sicherheit von Kindern eine Rolle spielen wird. Mehrfach diskriminierte Kinder und Jugendliche sollten nicht vergessen werden.
Melina studiert inzwischen in England an der University of Cambridge Politikwissenschaften. Sie denkt noch ab und zu an ihre Grundschulzeit zurück: „Viele meiner damaligen Mitschüler haben nicht zu träumen gewagt, eines Tages wegzuziehen oder zu studieren, weil wir niemanden kannten, der das gemacht hat.“ Die junge Frau nippt an ihrem Tee. „Aber einige meiner Freunde wollten und wollen Ärztinnen oder Lehrer werden; sie haben nur nicht die nötigen Ressourcen bekommen, um ihr Viertel zu verlassen.“ Die 18-Jährige wünscht sich eine Gerechtigkeit für die nächste Generation von Kindern, sodass jeder und jede seine und ihre Träume erreichen kann.
Dieser Artikel ist im Rahmen der offenen Redaktion entstanden. Bei Fragen, Anregungen, Kritik und wenn ihr selbst mitmachen mögt, schreibt uns eine Mail an redaktion@jugendpresse.de