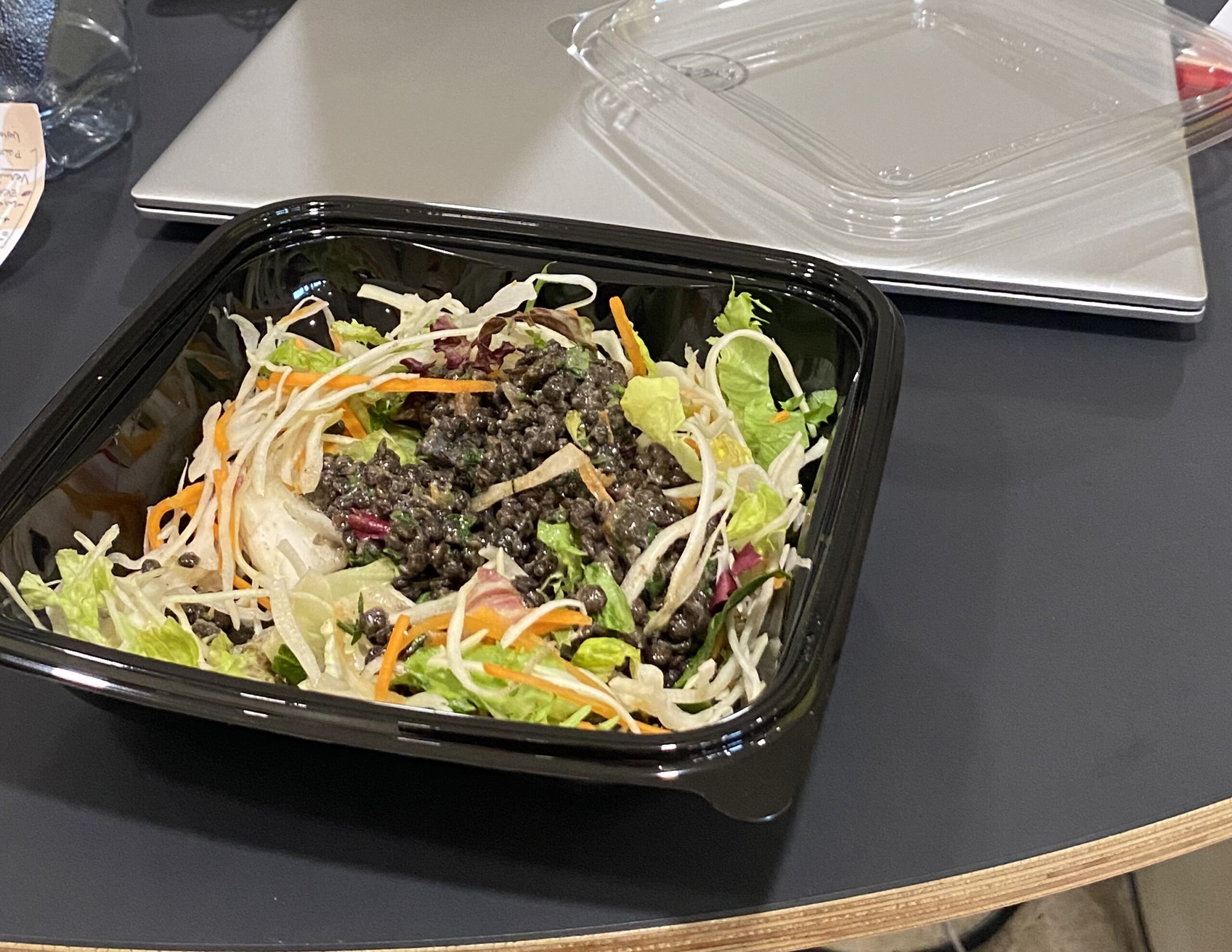Relevant, Umfangreich, Multidimensional- Ernährungssicherheit und Landwirtschaft in einer globalisierten Welt
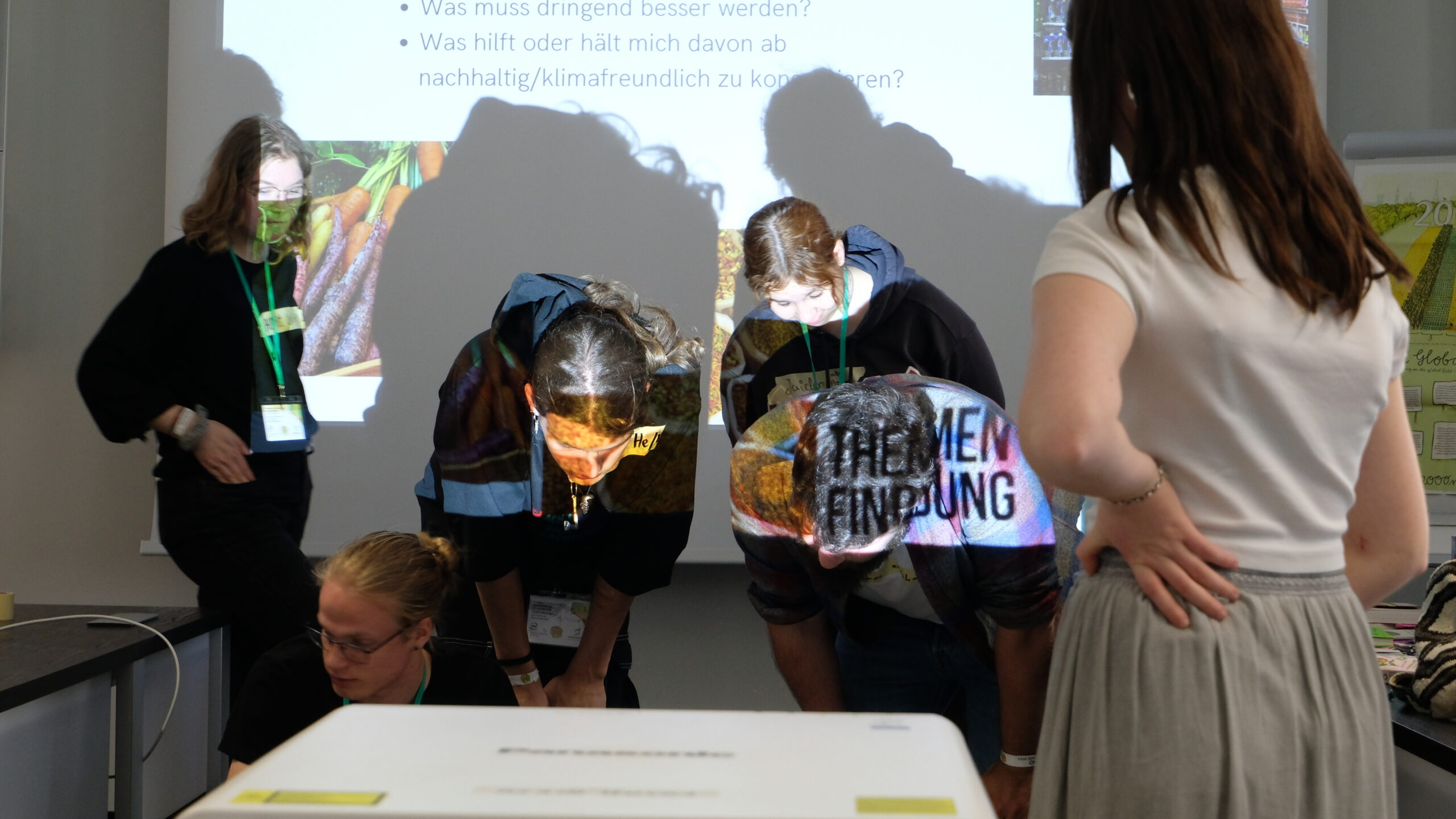
Ernährung mag unerheblich klingen, alltäglich, umfasst aber sehr viele und gesellschaftsrelevante Themen, die auf ganz verschiedenen Ebenen von Bedeutung sind.