“Den Osten” gibt es nicht
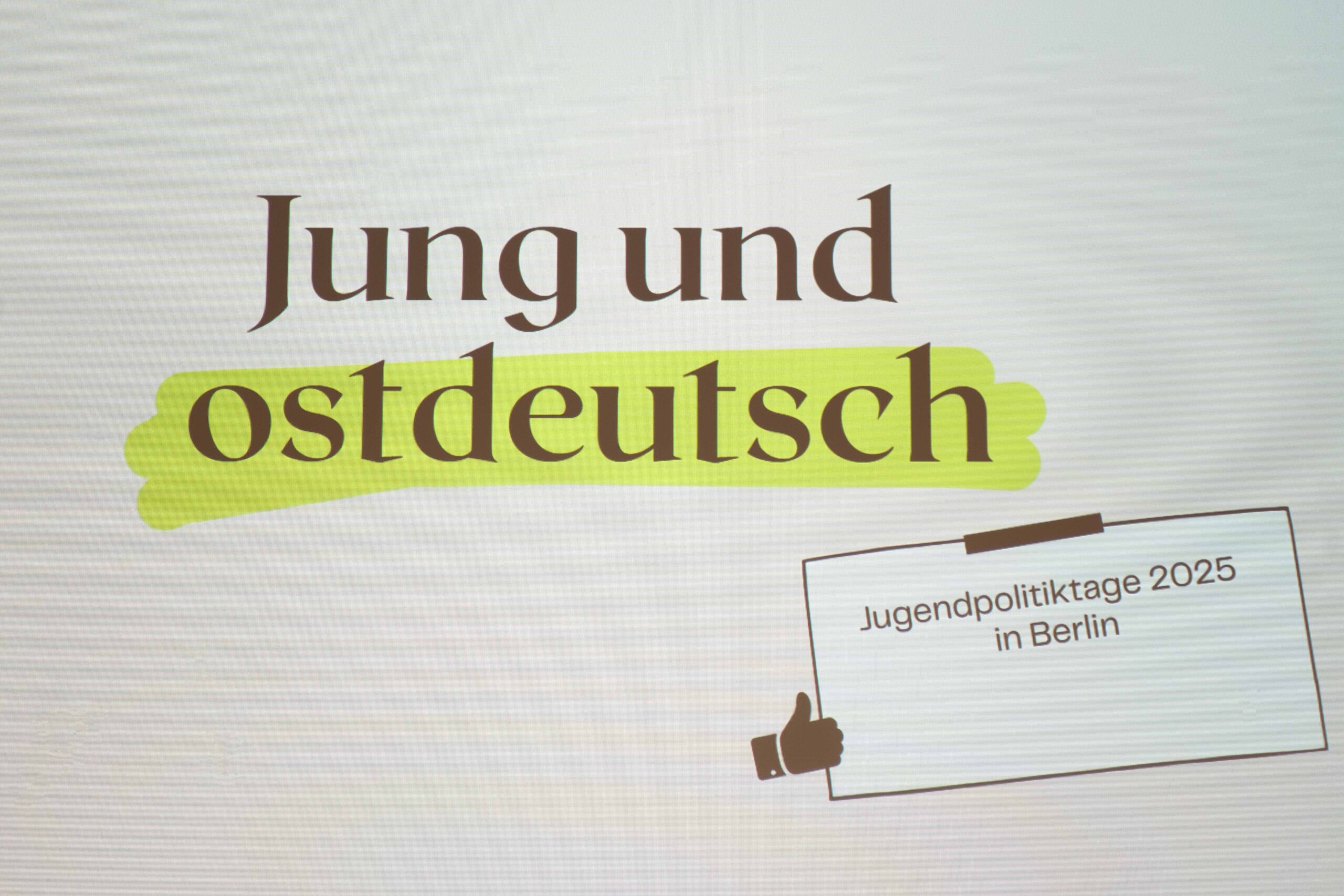
Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sprechen Menschen noch von “Ostdeutschland” – jedoch nie von “Westdeutschland”. Zeit, solche Schubladen und Stereotype hinter sich zu lassen.
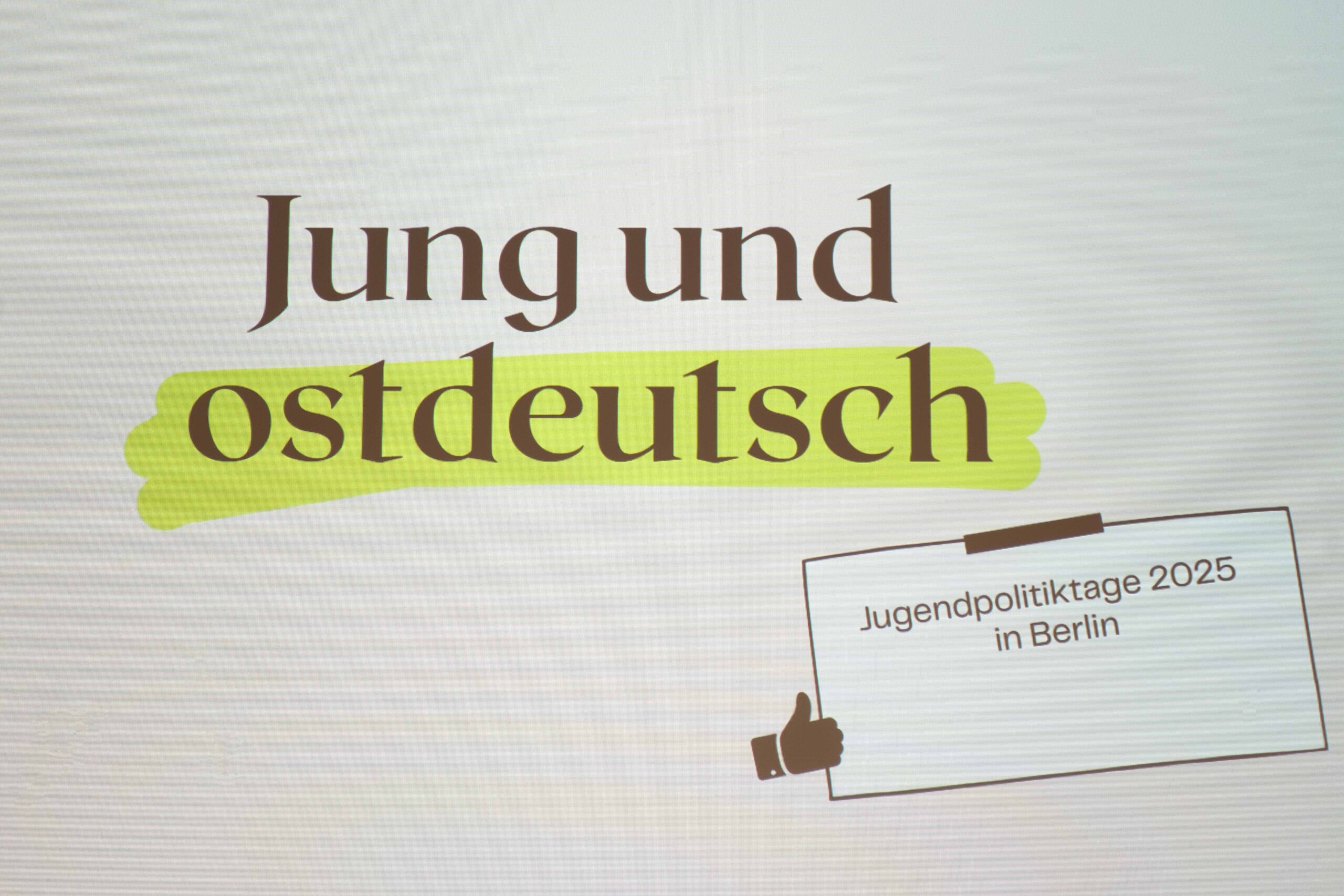
Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sprechen Menschen noch von “Ostdeutschland” – jedoch nie von “Westdeutschland”. Zeit, solche Schubladen und Stereotype hinter sich zu lassen.

Michel Friedmans autobiographischer Roman „Fremd“ wurde im Berliner Ensemble als Lesung inszeniert, bei der Sibel Kekilli dem Text Stimme und Gesicht lieh. Eine Rezension.

Warum denken wir bei Markus Söder an Bier und Wurst und nicht an politische Inhalte? Weil Kulturkampf wirkungsvoller ist, als über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen. Ein Kommentar.

Die diesjährigen Jugendpolitiktage haben begonnen und das nicht an irgendeinem Ort. Aber wo genau befinden wir uns eigentlich?