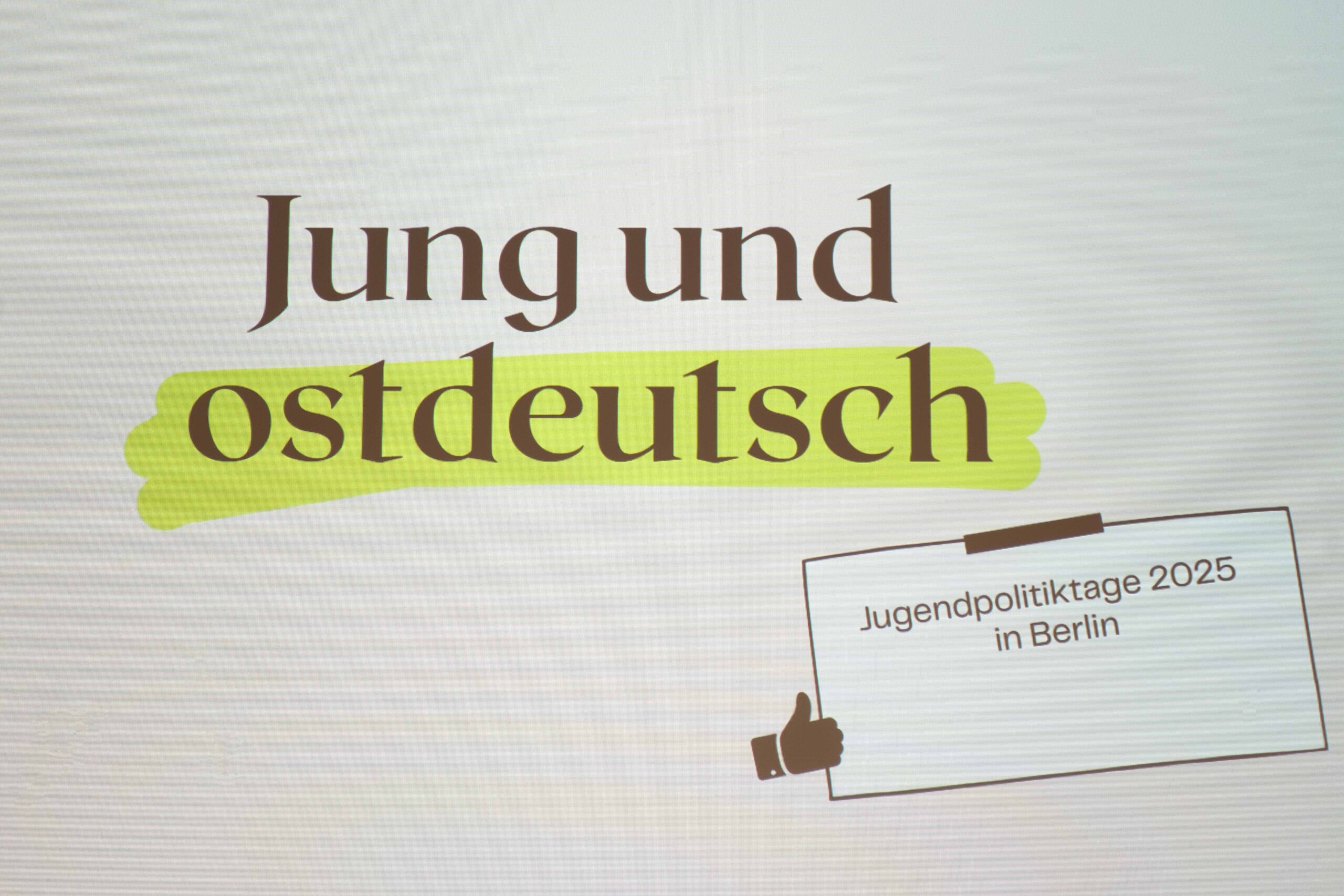Wehrpflichtdebatte – Wie jetzt?!

Wehrpflicht, Pflichtdienst, Freiwilligkeit – die Debatte über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht bewegt die Gesellschaft, insbesondere ihre jüngeren Mitglieder. Ein Überblick darüber, woher die Debatte nun kommt und welche Pläne und Reaktionen es gibt.