Jugendliche Protestkultur und die Rolle der Medien
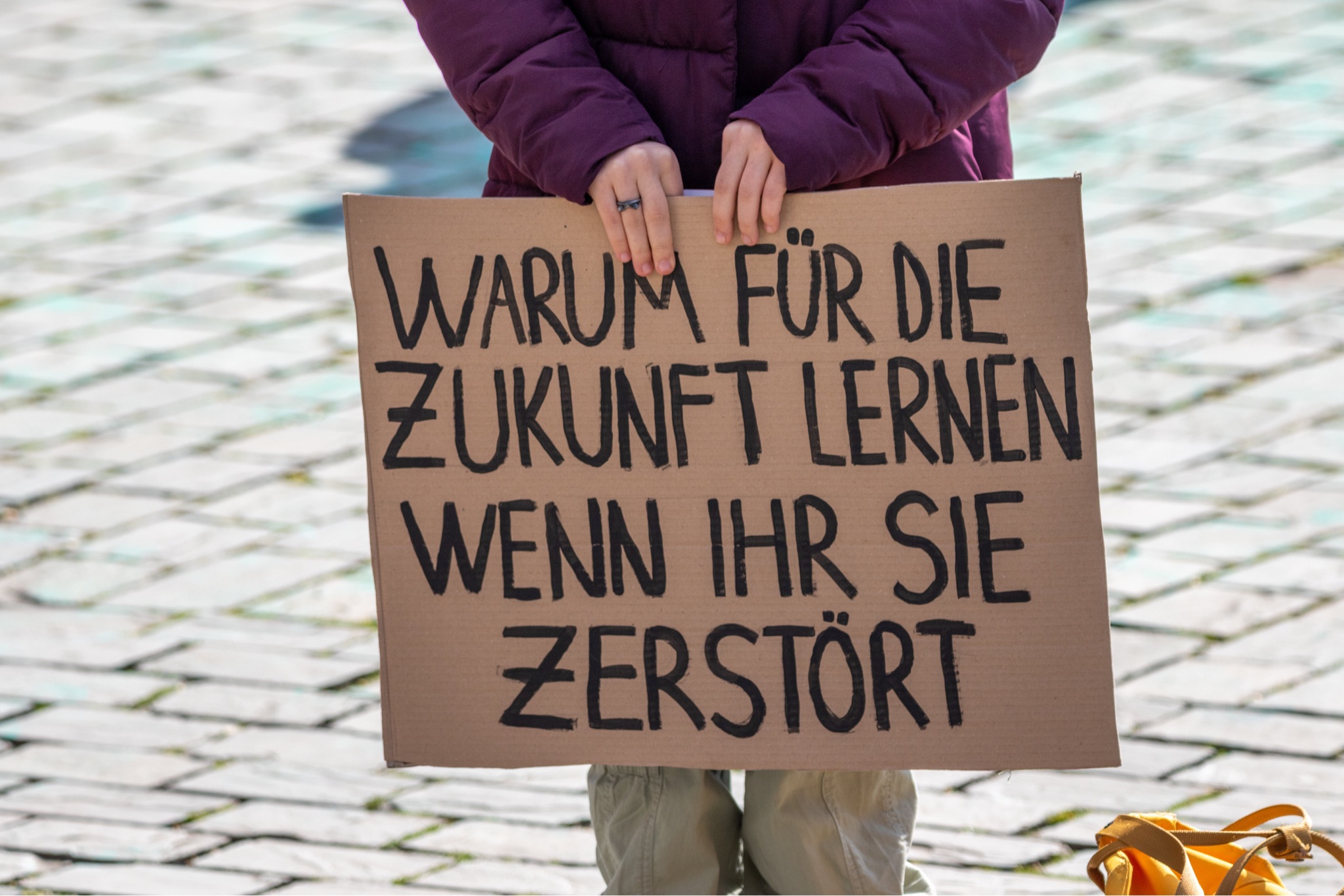
Wieso die Medien anders über Proteste von jungen Menschen berichten sollten. Ein Kommentar von Sophia Abegg.
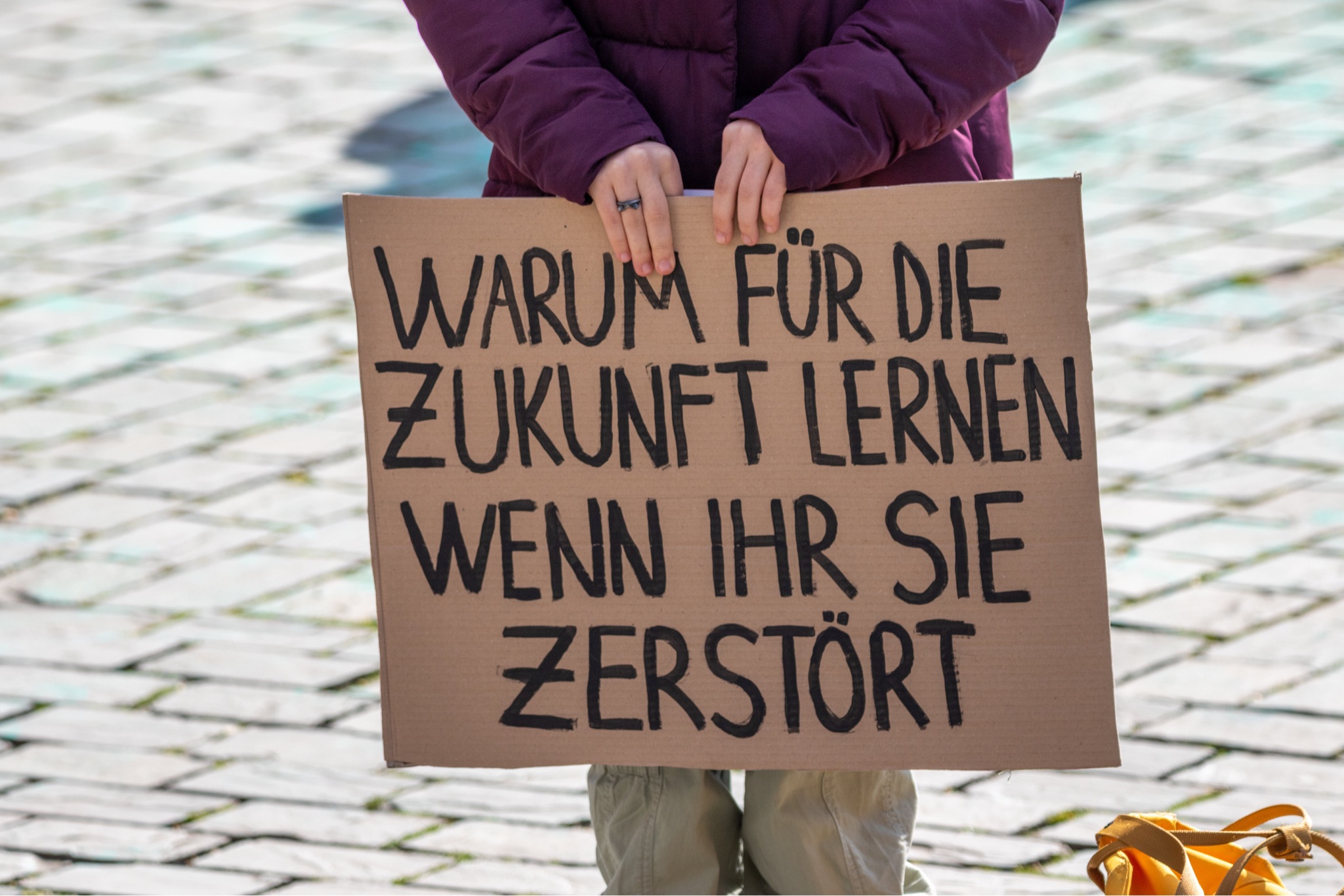
Wieso die Medien anders über Proteste von jungen Menschen berichten sollten. Ein Kommentar von Sophia Abegg.

Das Wahlrecht ab 16 Jahren würde es Jugendlichen möglich machen, aktiv an der Politik teilzunehmen. Doch würden die jungen Menschen diese Möglichkeit überhaupt nutzen

Echsenmenschen, Illuminaten und geheime Eliten. Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur. Über den Umgang mit ihnen, Skepsis, Misstrauen und Zweifel. Ein Text von Nils Hipp.

Das #EPJugendforum in Stuttgart diskutierte im Handelsausschuss einen EU-weiten Mindestlohn. Unser Redakteur Markus Güttler hat sich mit den Vor- und Nachteilen eines solchen Vorhabens kritisch auseinander gesetzt.

#EPjugendforum im Niedersächsischen Landtag in Hannover – etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesland treffen sich in der Landeshauptstadt, um gemeinsam und mit Politikprofis über die Zukunft Europas im Bereich Umwelt, Handel und Ernährung zu debattieren. Leonie Keller…

Es wurde debattiert und diskutiert. Einen Tag lang übernahm die Jugend beim #EPjugendforum die Sitze im Saar-Landtag und präsentierten dabei ihre Ideen zu Handel, Ernährung und Umwelt. Skender hat den Tag in Bildern eingefangen – eine Auswahl gibt es hier…

Gibt es einen Werteverfall in Deutschland? Und wenn ja – wäre das so schlimm? Ein Workshop sucht nach Antworten und stößt dabei auf immer neue Fragen. Jana Borchers hat die Debatte mitverfolgt.